Kleingewerbe gründen – Schritt für Schritt zur eigenen nebenberuflichen Selbstständigkeit
Sie möchten ein Kleingewerbe anmelden? Hier finden Sie alle Infos zu Voraussetzungen, Formularen und Versicherungen

Ein Kleingewerbe ist der ideale Weg, um in die Selbstständigkeit zu starten – ob nebenberuflich, mit kleinem Budget oder als erster Test für Ihre Geschäftsidee. Dabei profitieren Sie von klaren Regeln, geringen Einstiegshürden und steuerlichen Vorteilen.
Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Kleingewerbe erfolgreich anmelden, welche Voraussetzungen gelten und worauf Sie bei Versicherung, Steuern und Buchführung achten sollten.
Das Wichtigste auf einen Blick
Was ist ein Kleingewerbe?
Ein Kleingewerbe ist keine eigene Rechtsform, sondern beschreibt eine gewerbliche Tätigkeit, die bestimmte Kriterien erfüllt – vor allem in Bezug auf Umsatz, Betriebsstruktur und Buchführungspflichten. Es richtet sich an Gründer, die allein oder im kleinen Rahmen unternehmerisch tätig sein möchten, ohne direkt ein Handelsgewerbe oder eine Kapitalgesellschaft zu gründen.
Im Gegensatz zu Kaufleuten nach Handelsgesetzbuch (HGB) müssen Kleingewerbetreibende nicht ins Handelsregister eingetragen werden. Sie führen keine doppelte Buchführung, sondern nutzen die vereinfachte Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR). Auch ein Mindestkapital ist nicht erforderlich – das reduziert die Einstiegshürden erheblich.
Ein Kleingewerbe kann z. B. als Einzelunternehmen oder als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrieben werden. In beiden Fällen haften die Unternehmer unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen, was bei der Absicherung unbedingt berücksichtigt werden sollte.
Wichtig: Der Begriff „Kleingewerbe“ ist vom steuerlichen Status als Kleinunternehmer zu unterscheiden. Letzterer bezieht sich auf die Umsatzsteuerregelung nach §19 UStG – und kann, muss aber nicht beim Kleingewerbe greifen. Wer als Kleinunternehmer gilt, darf im Vorjahr maximal 22.000 € Umsatz und im laufenden Jahr maximal 50.000 € Umsatz erwirtschaften. Darüber hinaus gelten reguläre umsatzsteuerliche Pflichten.
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
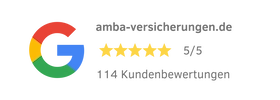
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Die Schritte zur Kleingewerbe-Gründung
Der Weg in die Selbstständigkeit beginnt mit einer klaren Idee – und dem Wissen, wie Sie Ihre Gründung formal und rechtlich richtig angehen. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte notwendig sind und wie Sie typische Stolperfallen vermeiden.

Geschäftsidee und Zielgruppe definieren
Ein Kleingewerbe beginnt mit einer Idee, die einfach umsetzbar ist und echten Bedarf trifft.

Businessplan & rechtliche Vorbereitung
Auch beim Kleingewerbe hilft ein Businessplan, Klarheit zu schaffen – z. B. zu Kosten, Rechtsform und Risiken.

Anmeldung beim Gewerbeamt & steuerliche Erfassung
Die Anmeldung beim Gewerbeamt ist schnell erledigt – wir zeigen, was Sie dafür brauchen und wie es geht.

Geschäft organisieren
Ein Geschäftskonto, eine sinnvolle Absicherung und einfache Buchführung bilden das Fundament Ihrer Selbstständigkeit.

Nebenerwerb & Förderung
Welche Möglichkeiten haben Sie im Nebenerwerb? Welche Förderungen gibt es? Wir geben Ihnen praktische Impulse.
Ein starkes Kleingewerbe beginnt mit einer klaren Idee und echter Relevanz
Geschäftsidee und Zielgruppe entwickeln
Die Grundlage jedes erfolgreichen Kleingewerbes ist eine Idee, die sich leicht umsetzen lässt – und ein Markt, der genau darauf wartet.
Bevor Sie den ersten Antrag ausfüllen oder sich mit Formularen befassen, steht eine Frage im Mittelpunkt: Was möchten Sie anbieten – und für wen? Die Geschäftsidee ist das Herzstück Ihres Vorhabens. Sie muss nicht revolutionär sein – aber sie sollte ein konkretes Problem lösen oder ein bestehendes Bedürfnis besser bedienen als der Wettbewerb.
Ein Kleingewerbe eignet sich besonders gut für spezialisierte Dienstleistungen, handwerkliche Tätigkeiten, kreative Produkte oder digitale Angebote – ob nebenberuflich oder als flexibler Start in die Selbstständigkeit.
Wir empfehlen, sich bei der Entwicklung Ihrer Geschäftsidee folgende Fragen zu stellen:
Welche Erfahrungen oder Fähigkeiten bringen Sie mit?
Wofür gibt es bereits Nachfrage – und wo erkennen Sie Lücken im Markt?
Welche Zielgruppe möchten Sie ansprechen?
Können Sie Ihre Leistung klar und verständlich beschreiben – in einem Satz?
Um Ihre Zielgruppe besser zu verstehen, bietet sich die Entwicklung sogenannter Personas an: fiktive, aber realitätsnahe Profile typischer Kunden. Je genauer Sie wissen, was Ihre Kunden wollen, wie sie denken und wo sie sich aufhalten, desto gezielter können Sie Ihr Angebot, Ihre Kommunikation und Ihre Preisgestaltung ausrichten.
Eine gute Geschäftsidee ist immer die Summe aus: eigenen Stärken, klarem Kundennutzen und Marktfähigkeit. Wenn Sie diese drei Punkte erfüllen, haben Sie bereits den wichtigsten Grundstein für Ihr Kleingewerbe gelegt.
Ein klarer Plan bringt Sicherheit – auch ohne großen Aufwand
Businessplan & rechtliche Grundlagen
Auch beim Kleingewerbe lohnt es sich, wichtige Grundlagen schriftlich zu durchdenken – besonders in Bezug auf Ziele, Finanzierung und rechtliche Vorgaben.
Ein klassischer Businessplan ist für ein Kleingewerbe zwar nicht verpflichtend – doch er ist ein wertvolles Werkzeug, um Struktur, Klarheit und Sicherheit zu schaffen. Gerade wenn Sie Ihr Vorhaben nebenberuflich starten oder langfristig ausbauen möchten, hilft ein einfacher Plan, die nächsten Schritte besser zu überblicken.
Folgende Fragen sollten Sie vorab für sich beantworten:
Welche Produkte oder Dienstleistungen biete ich an?
Welche Zielgruppe spreche ich an?
Welche Kosten kommen auf mich zu?
Wie viel Umsatz ist realistisch?
Welche rechtlichen Voraussetzungen gelten?
Ein Businessplan muss kein dickes PDF sein – ein übersichtliches Konzept auf wenigen Seiten reicht völlig aus. Wichtig ist, dass Sie sich mit Themen wie Preismodell, Kundengewinnung, Marktanalyse und Kostenstruktur auseinandersetzen. So vermeiden Sie Überraschungen und treffen von Anfang an bessere Entscheidungen.
Auch rechtlich gibt es einige Grundlagen zu beachten:
Rechtsform: Die meisten Kleingewerbe starten als Einzelunternehmen oder GbR. Ein Mindestkapital ist nicht nötig, allerdings haften Sie mit Ihrem Privatvermögen.
Nebenerwerb oder Hauptgewerbe: Je nach Umfang der Tätigkeit muss ggf. der Arbeitgeber informiert oder eine Genehmigung eingeholt werden.
Pflichten gegenüber Behörden: Sie müssen sich beim Gewerbeamt anmelden und nach der Anmeldung einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt einreichen.
Kleinunternehmerregelung: Wenn Sie unter bestimmten Umsatzgrenzen bleiben, können Sie sich von der Umsatzsteuerpflicht befreien lassen (§19 UStG).
Halten Sie Ihre Planung einfach, aber präzise – und denken Sie auch an „unsichtbare“ Punkte wie Versicherungen, Rücklagen und Zeitaufwand. Gerade im Kleingewerbe kann gute Planung langfristig über Erfolg oder Scheitern entscheiden.
Schnell erledigt – mit diesen Schritten ist Ihr Kleingewerbe offiziell angemeldet
Gewerbeanmeldung & steuerliche Erfassung
Die Anmeldung Ihres Kleingewerbes erfolgt beim Gewerbeamt – in vielen Städten sogar online. Danach geht es direkt weiter mit dem steuerlichen Fragebogen beim Finanzamt.
Die Anmeldung eines Kleingewerbes ist unkompliziert und innerhalb weniger Tage erledigt. Zuständig ist das örtliche Gewerbeamt, das Sie persönlich, schriftlich oder häufig auch digital erreichen. Mit der Anmeldung schaffen Sie die rechtliche Grundlage für Ihre gewerbliche Tätigkeit – egal ob im Nebenerwerb oder hauptberuflich.
Für die Anmeldung benötigen Sie:
ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass)
die ausgefüllte Gewerbeanmeldung (Formular vor Ort oder online)
je nach Tätigkeit: zusätzliche Unterlagen wie polizeiliches Führungszeugnis, Handwerkskarte oder Nachweise über Qualifikationen
Die Gebühren liegen je nach Stadt oder Gemeinde meist zwischen 20 und 60 Euro. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Gewerbeanmeldebescheinigung – damit ist Ihr Kleingewerbe offiziell registriert.
Im nächsten Schritt meldet sich das Finanzamt bei Ihnen. Sie erhalten den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den Sie innerhalb von vier Wochen ausfüllen und zurücksenden müssen – entweder klassisch in Papierform oder direkt online über ELSTER. In diesem Fragebogen geben Sie u. a. an:
Ihre Kontaktdaten und die Art Ihrer Tätigkeit
ob Sie die Kleinunternehmerregelung nach §19 UStG nutzen möchten
eine Schätzung Ihrer zu erwartenden Umsätze und Gewinne
Ihre steuerliche Erfassungsnummer (falls bereits vorhanden)
Wenn Sie unterhalb der Umsatzgrenze von 22.000 € (Vorjahr) und 50.000 € (laufendes Jahr) bleiben möchten, sollten Sie die Kleinunternehmerregelung bewusst wählen – so sparen Sie sich die Umsatzsteuerpflicht und damit verbundenen Verwaltungsaufwand.
Sobald das Finanzamt Ihre Angaben geprüft hat, erhalten Sie Ihre Steuernummer für das Gewerbe – und können rechtssicher Rechnungen schreiben. Damit ist der formale Teil Ihrer Gründung abgeschlossen.
Sicherheit, Überblick, Ordnung – das Fundament für Ihre Selbstständigkeit
Organisation: Geschäftskonto, Versicherung & Buchführung
Wer sein Kleingewerbe von Anfang an professionell aufstellt, schafft Klarheit – und beugt Risiken sowie unnötigem Stress vor.
Auch wenn ein Kleingewerbe mit wenig Bürokratie auskommt – bestimmte organisatorische Grundlagen sollten Sie von Beginn an sauber umsetzen. Dazu zählen ein separates Geschäftskonto, grundlegender Versicherungsschutz sowie eine einfache, aber korrekte Buchführung.
💼 Geschäftskonto – privat und geschäftlich trennen
Ein eigenes Firmenkonto ist zwar nicht verpflichtend, aber dringend zu empfehlen. Es hilft Ihnen, private und geschäftliche Finanzen klar zu trennen – und vereinfacht Buchhaltung, Steuererklärung und Nachweise gegenüber Ämtern oder Banken. Viele Anbieter bieten kostenlose oder günstige Geschäftskonten speziell für Selbstständige und Kleingewerbetreibende an.
🛡️ Versicherung – Ihr Schutz bei Schäden und Forderungen
Auch mit kleinen Umsätzen können große Risiken entstehen. Eine Betriebshaftpflichtversicherung schützt Sie, wenn Dritte durch Ihre Tätigkeit oder Produkte zu Schaden kommen. Bei der Lagerung von Waren oder Geräten kann zudem eine Inhaltsversicherung sinnvoll sein – sie ersetzt Schäden durch Einbruch, Wasser, Feuer oder Vandalismus.
Beratende Tätigkeiten oder digitale Leistungen erfordern unter Umständen auch eine Vermögensschadenhaftpflicht oder Cyberversicherung.
📊 Buchführung – einfach, aber korrekt
Als Kleingewerbetreibender sind Sie von der doppelten Buchführung befreit. Stattdessen reicht in den meisten Fällen die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR). Hier erfassen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt – idealerweise monatlich und lückenlos.
💡 Tipp: Nutzen Sie eine einfache Buchhaltungssoftware oder eine App, um Quittungen, Rechnungen und Belege digital zu sammeln. So behalten Sie jederzeit den Überblick.
Welche Versicherungen Onlineshop-Betreiber wirklich brauchen

Betriebshaftpflicht
Ein Sturz beim Kundentermin oder ein Schaden durch Ihre Dienstleistung kann teuer werden. Die Betriebshaftpflicht übernimmt berechtigte Schadensersatzforderungen – und wehrt unberechtigte ab. Für alle Kleingewerbetreibenden mit Kundenkontakt ein Muss.

Inhaltsversicherung
Ob Wasserschaden, Einbruch oder Feuer: Wenn Ihre Ausstattung oder Ihre Lagerware beschädigt wird, kann das teuer werden. Die Inhaltsversicherung sichert Ihr Kleingewerbe gegen solche Risiken ab – damit Sie schnell wieder arbeitsfähig sind.
Doch damit nicht genug
Je nach Geschäftsmodell und persönlichem Risiko können weitere Versicherungen sinnvoll sein:
Staatliche Hilfen nutzen, nebenbei starten – und später weiterentwickeln
Förderung & Perspektiven im Kleingewerbe
Ein Kleingewerbe ist nicht nur ein einfacher Einstieg – es kann auch gefördert werden und sich bei Bedarf weiterentwickeln. Wir zeigen Ihnen, welche Optionen Sie haben.
Ein Kleingewerbe kann die Basis für vieles sein: den Start in die Selbstständigkeit, ein zweites Standbein neben dem Hauptjob oder ein sanfter Übergang aus einer Anstellung in die Unabhängigkeit. Umso wichtiger ist es, die Entwicklungsmöglichkeiten und Förderangebote von Anfang an im Blick zu haben.
Nebenerwerb als Einstieg
Viele Gründer starten ihr Kleingewerbe zunächst nebenberuflich – etwa abends, am Wochenende oder in Teilzeit. Wichtig ist dabei die Absprache mit dem Arbeitgeber, sofern ein Arbeitsvertrag besteht. In der Regel ist ein Kleingewerbe erlaubt, solange es nicht in Konkurrenz steht und der Hauptjob nicht leidet.
Nebenberuflich zu gründen hat Vorteile: Sie bleiben finanziell abgesichert und können Risiken gering halten, während Sie Ihr Geschäftsmodell testen und erste Kunden gewinnen.
Förderprogramme für Gründer
Je nach Bundesland und individueller Situation können Sie von verschiedenen Förderprogrammen profitieren:
Gründungszuschuss (für ALG-I-Empfänger)
Einstiegsgeld (für ALG-II-Empfänger)
Mikrokredite oder zinsgünstige KfW-Gründerdarlehen
Förderungen für Frauen, junge Gründer oder regionale Projekte
Auch Beratungszuschüsse sind möglich – etwa für Existenzgründer-Coachings oder betriebswirtschaftliche Beratung. Die Anträge dafür laufen meist über die IHK, HWK oder das zuständige Jobcenter.
Langfristige Entwicklung: vom Kleingewerbe zur Firma
Viele Unternehmer bleiben dauerhaft im Kleingewerbe – andere wollen wachsen. Sobald Sie regelmäßig höhere Umsätze erzielen oder Mitarbeitende einstellen, kann der Schritt zur Eintragung ins Handelsregister oder zur Gründung einer Kapitalgesellschaft (z. B. UG, GmbH) sinnvoll sein.
Planen Sie langfristig – auch wenn Sie klein starten. Wer bereits im Kleingewerbe vorausschauend handelt, kann bei Bedarf schneller skalieren und professionell auftreten.
Vier Wege in die Selbstständigkeit – welche Form passt zu Ihrem Vorhaben?
Der Einstieg in die berufliche Selbstständigkeit kann auf unterschiedliche Weise gelingen – je nach Lebensphase, Risikobereitschaft und finanzieller Situation. Manche gründen klassisch mit eigener Firma, andere wählen bewusst den leichteren Weg über ein Kleingewerbe oder einen Onlineshop. Auch die Übernahme eines bestehenden Betriebs ist eine realistische und oft unterschätzte Alternative.
In der folgenden Übersicht zeigen wir Ihnen die vier häufigsten Gründungsformen – kompakt erklärt und direkt verlinkt.
Die klassische Unternehmensgründung mit vollständiger Verantwortung, eigenem Namen und maximaler Freiheit.
Hier entwickeln Sie Ihr Geschäftsmodell von Grund auf – mit klarer Strategie, möglichem Kapitalbedarf und echtem Wachstumspotenzial.
Die unkomplizierte Gründungsform mit wenig Bürokratie – ideal für nebenberuflichen Start oder erste Tests.
Ein Kleingewerbe lässt sich schnell anmelden, verursacht geringe Kosten und bietet flexible Entwicklungsmöglichkeiten.
Digital starten – mit Produkten, Plattform und einer klaren E‑Commerce-Strategie.
Ein Onlineshop bietet ortsunabhängige Einkommensmöglichkeiten – mit vielen Tools, aber auch rechtlichen Anforderungen.
Ein bestehendes Unternehmen übernehmen und von Anfang an durchstarten.
Die Übernahme eines Betriebs spart Zeit beim Aufbau, kann jedoch Investitionen und Führungserfahrung erfordern.
Zusammenfassung
Ein Kleingewerbe ist der perfekte Einstieg in die Selbstständigkeit – besonders dann, wenn Sie klein starten, wenig Risiko eingehen und flexibel agieren möchten. Die Gründung ist unkompliziert, die laufenden Kosten gering, und viele bürokratische Hürden entfallen.
Mit einer durchdachten Geschäftsidee, der richtigen Anmeldung beim Gewerbeamt und einem Blick auf steuerliche und versicherungstechnische Grundlagen legen Sie den Grundstein für ein rechtssicheres und stabiles Kleingewerbe.
Ob nebenberuflich, saisonal oder als Testlauf für etwas Größeres – das Kleingewerbe bietet Ihnen viele Möglichkeiten und kann der erste Schritt in eine erfolgreiche Unternehmerzukunft sein.
häufige Fragen
Wie viel Geld darf man bei einem Kleingewerbe verdienen?
Ein Kleingewerbe unterliegt keiner festen Einkommensgrenze. Für die steuerliche Kleinunternehmerregelung nach §19 UStG gilt: Der Umsatz darf im Vorjahr 22.000 Euro und im laufenden Jahr 50.000 Euro nicht überschreiten. Für Sozialabgaben oder Förderungen können je nach Lebenslage weitere Grenzen gelten.
Wie teuer ist ein Kleingewerbe im Monat?
Die laufenden Kosten für ein Kleingewerbe sind in der Regel gering. Zu den typischen Posten zählen z. B. IHK/HWK-Beiträge, Versicherungskosten, ggf. Steuerberatung, Geschäftskonto oder Buchhaltungssoftware. Rechnen Sie im Durchschnitt mit 30–100 Euro pro Monat, je nach Umfang und Bedarf.
Wann lohnt sich Kleingewerbe?
Ein Kleingewerbe lohnt sich besonders, wenn Sie mit wenig Kapital starten möchten, nebenberuflich gründen oder eine Geschäftsidee testen wollen. Auch für Freelancer, Kreative oder Dienstleister ist es eine flexible, kostengünstige und unkomplizierte Gründungsform – ohne Handelsregisterpflicht.
Wie viel muss ich verdienen, um ein Kleingewerbe anzumelden?
Sie müssen keine bestimmte Einnahmegrenze überschreiten, um ein Kleingewerbe anzumelden. Sobald Sie eine gewerbliche Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht aufnehmen – selbst mit kleinstem Umsatz – besteht die Pflicht zur Anmeldung beim Gewerbeamt.

