BU-Statistik – wie häufig Berufsunfähigkeit eintritt und wer betroffen ist
Jeder vierte Erwerbstätige wird berufsunfähig – wir zeigen Ursachen, Verteilung nach Alter, Geschlecht und Beruf

Die Berufsunfähigkeitsstatistik zeigt eine klare Realität: Rund jeder vierte Angestellte und fast jeder dritte Arbeiter in Deutschland wird im Laufe seines Erwerbslebens berufsunfähig. Psychische Erkrankungen sind heute die häufigste Ursache – noch vor Rückenleiden, Krebs und Unfällen. Besonders auffällig: Die Risiken variieren deutlich nach Alter, Gesundheitszustand und Lebensstil. In dieser Übersicht zeigen wir, wer besonders gefährdet ist, welche Erkrankungen dominieren und wie lange eine Berufsunfähigkeit durchschnittlich dauert. Außerdem erfahren Sie, was diese Zahlen für Ihre Vorsorge bedeuten.
Das Wichtigste auf einem Blick
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
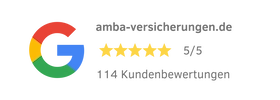
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Wer betroffen ist, zeigt die Statistik – und die unterschätzte Realität
Wie häufig ist Berufsunfähigkeit – und wen trifft es?
Die Frage „Wie wahrscheinlich ist es, berufsunfähig zu werden?“ lässt sich längst nicht mehr mit einem Schulterzucken beantworten. Die Statistik zeigt, dass Erwerbstätige aller Altersgruppen betroffen sein können – unabhängig von Beruf, Geschlecht oder Lebensstil. Besonders alarmierend: Viele unterschätzen ihr persönliches Risiko und sichern sich zu spät ab. Dabei ist Berufsunfähigkeit keine Ausnahme, sondern ein weit verbreitetes Phänomen – mit teils gravierenden finanziellen Folgen. Unsere Übersicht liefert einen klaren Einblick in die Zahlen, Quoten und Hintergründe.
Jeder vierte Angestellte und fast jeder dritte Arbeiter wird berufsunfähig (M&M 2025).
Besonders gefährdet: Menschen mit Stressberufen, körperlich Belasteten oder mit Vorerkrankungen.
Jüngere unterschätzen das Risiko häufig – gerade hier kann eine frühe Absicherung entscheidend sein.
Das durchschnittliche Eintrittsalter liegt zwischen 44 und 47 Jahren – viele sind mitten im Berufsleben betroffen.
Die durchschnittliche Leistungsdauer liegt bei 6–7 Jahren – oft länger bei chronischen oder psychischen Leiden.
BU-Renten beginnen nach rund 160 Tagen – eine finanzielle Lücke entsteht meist sofort.
Unter 40: steigende Zahl an psychisch bedingten BU-Fällen (Burnout, Depression, Angst).
Über 50: deutlich höhere BU-Quote durch Krebs, Herz-Kreislauf, Bewegungsapparat.
Fazit: Jede Altersgruppe hat typische Risiken – eine einheitliche Absicherung ist kaum möglich.
BU durch Unfall, spontane Krankheit oder Erschöpfung kann jeden treffen – unabhängig vom Gesundheitszustand.
Besonders bei neuen Berufsbildern (z. B. IT, Pflege, Bildung) steigt das Risiko unbemerkt.
Die Statistik zeigt: Berufsunfähigkeit ist keine Ausnahme, sondern ein realistisches Szenario.
Erkrankungen, Unfälle, psychische Belastung – die Hauptursachen im Überblick
Die häufigsten Auslöser – was führt zur Berufsunfähigkeit?
Berufsunfähigkeit trifft selten aus heiterem Himmel. Die Ursachen lassen sich statistisch eindeutig erfassen – und sie folgen einem klaren Muster: Psychische Erkrankungen sind heute der häufigste Auslöser, gefolgt von Beschwerden des Bewegungsapparats, Krebserkrankungen und Unfällen. Diese Diagnosegruppen stehen für rund 80 % aller BU-Fälle. Auffällig ist auch der Zusammenhang zwischen Alter und Ursache: Während bei jungen Erwachsenen psychische Belastungen dominieren, nehmen bei älteren Menschen körperliche Leiden zu. In diesem Abschnitt werfen wir einen fundierten Blick auf die wichtigsten Auslöser – gestützt auf aktuelle Studien und Auswertungen führender Versicherer.
Die aktuellsten Zahlen aus dem M&M Marktblick 2025 und der GDV-Statistik belegen: Psychische Erkrankungen sind mit 34,23 % die Hauptursache für Berufsunfähigkeit. Dazu zählen Depressionen, Angststörungen, Burnout sowie psychosomatische Störungen. Besonders häufig betroffen sind jüngere Berufstätige unter 40 Jahren – vor allem Frauen. Der steigende Leistungsdruck im Job, ständige Erreichbarkeit und private Belastungen tragen dazu bei, dass psychische Erkrankungen zu einer der größten Gesundheitsgefahren im Berufsleben geworden sind.
An zweiter Stelle folgen Erkrankungen des Bewegungsapparats – insbesondere Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle, Arthrose und Gelenkbeschwerden. Diese betreffen vor allem Personen in körperlich fordernden Berufen, z. B. im Bau, in der Logistik oder Pflege. Laut Statistik sind rund 19,38 % aller BU-Fälle auf diese Art von Erkrankungen zurückzuführen.
Krebserkrankungen zählen mit rund 16–17 % ebenfalls zu den häufigsten Ursachen. Insbesondere bei Arbeitnehmern über 50 nehmen die Diagnosen und damit die BU-Fälle deutlich zu. Hierzu gehören bösartige Tumorerkrankungen, aber auch chronische Krebsverläufe, die eine Rückkehr ins Berufsleben unmöglich machen.
Unfälle sind in etwa 9 % der Fälle verantwortlich, wobei Freizeit‑, Verkehrs- und Sportunfälle die größten Anteile ausmachen. Auch wenn Unfälle zahlenmäßig hinter Erkrankungen liegen, führen sie oft zu plötzlicher und langfristiger Berufsunfähigkeit – etwa durch Querschnittslähmungen, Amputationen oder schwere Kopfverletzungen.
Weitere Ursachen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ca. 6 %), neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose sowie Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Diese treten vermehrt im höheren Alter auf, zeigen sich aber zunehmend auch bei jüngeren Menschen – oft infolge eines ungesunden Lebensstils.
Die Statistik offenbart deutlich: Berufsunfähigkeit entsteht nicht allein durch körperliche Schwerarbeit oder einen Unfall. Sie ist das Ergebnis komplexer Wechselwirkungen aus Beruf, Gesundheit, Alter, Umfeld und Lebensweise. Wer diese Risiken kennt, kann frühzeitig gegensteuern – mit medizinischer Vorsorge ebenso wie mit der passenden Absicherung.
Die unterschätzte Gefahr – psychische Erkrankungen als führender Auslöser
Unsichtbare Belastung: Psychische Ursachen im Fokus
Psychische Erkrankungen sind längst zur häufigsten Ursache für Berufsunfähigkeit geworden – und stellen Betroffene wie Arbeitgeber vor besondere Herausforderungen. Während körperliche Beschwerden oft sichtbar sind, verlaufen seelische Erkrankungen im Verborgenen. Die Folgen für die Arbeitsfähigkeit sind dennoch gravierend. Warum psychische Leiden gerade bei jungen Erwachsenen stark zunehmen und was das für die persönliche Vorsorge bedeutet, erfahren Sie hier.
Mit einem Anteil von über 34 % aller anerkannten Leistungsfälle liegen psychische Erkrankungen mittlerweile deutlich vor allen anderen Ursachen für Berufsunfähigkeit. Dazu zählen insbesondere Depressionen, Angststörungen, Erschöpfungssyndrome (z. B. Burnout), Schizophrenie und psychosomatische Beschwerden. Die Auswirkungen auf die berufliche Leistungsfähigkeit sind oft tiefgreifend und langanhaltend – viele Betroffene können dauerhaft nicht mehr in ihren erlernten Beruf zurückkehren.
Besonders auffällig: Psychische Erkrankungen treten überproportional häufig bei jüngeren Arbeitnehmern auf. Stress in Ausbildung oder Studium, hohe Leistungsanforderungen im Beruf, mangelnde Erholung und der zunehmende Druck durch digitale Erreichbarkeit wirken sich negativ auf die mentale Gesundheit aus. Die M&M‑Studie 2025 zeigt, dass gerade Frauen unter 40 Jahren deutlich häufiger betroffen sind als noch vor 10 oder 15 Jahren – mit einem Anstieg des Risikos um über 30 %.
Viele Menschen zögern, sich bei psychischen Symptomen Hilfe zu suchen – aus Angst vor Stigmatisierung oder beruflichen Nachteilen. Dadurch verschärft sich die Lage oft, bis der Arbeitsalltag nicht mehr bewältigt werden kann. Auch Arbeitgeber tun sich häufig schwer damit, psychische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen oder angemessen zu reagieren.
Ein weiterer Risikofaktor sind psychisch belastende Berufsfelder wie Pflege, Soziales, Pädagogik, IT oder Medien. Hier treffen hohe Verantwortung, Zeitdruck und emotionale Anforderungen aufeinander – oft verbunden mit einer schlechten Work-Life-Balance.
Auch im privaten Umfeld können Auslöser liegen: familiäre Konflikte, Pflege von Angehörigen, Trennung oder finanzielle Sorgen verstärken die psychische Belastung zusätzlich. Wer keine Möglichkeit zur Erholung oder keine stabile soziale Unterstützung hat, gerät leichter in eine gesundheitlich kritische Situation.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung spielt bei psychischen Erkrankungen eine entscheidende Rolle. Da viele Krankheitsverläufe chronisch oder schubweise verlaufen, sichern BU-Tarife langfristige finanzielle Stabilität – oft über mehrere Jahre hinweg. Wichtig ist dabei, dass psychische Erkrankungen im Antrag korrekt angegeben werden und keine Ausschlüsse vereinbart sind.
Unser Tipp: Achten Sie beim Abschluss Ihrer BU-Versicherung auf transparente Gesundheitsfragen, faire Bedingungen bei psychischen Diagnosen und umfassende Nachversicherungsmöglichkeiten. Wer frühzeitig vorsorgt, profitiert nicht nur von besseren Konditionen, sondern auch von der beruhigenden Gewissheit, im Ernstfall abgesichert zu sein.
Vertiefen Sie Ihr Wissen – passende Themen rund um Ihre Absicherung
Mehr zur Berufsunfähigkeit: Diese Beiträge könnten Sie ebenfalls interessieren
Sie möchten noch tiefer einsteigen oder planen den Abschluss einer BU-Versicherung? Dann empfehlen wir Ihnen diese Beiträge – sie liefern konkrete Antworten auf häufige Fragen und helfen Ihnen bei der fundierten Entscheidungsfindung.
Kosten Berufsunfähigkeitsversicherung

Wie viel kostet eine gute BU-Versicherung – und wovon hängen die Beiträge ab? Wir zeigen Ihnen, welche Faktoren den Preis beeinflussen, wie Sie sparen können und worauf es bei der Tarifwahl wirklich ankommt.
Anonyme Risikovoranfrage

Vorerkrankung, gefährlicher Beruf oder Sport? Mit einer anonymen Risikovoranfrage prüfen Sie Ihre Chancen auf Versicherungsschutz – ohne Risiko für spätere Ablehnungen. Wir erklären, wie das funktioniert.
BU-Versicherung mit Altersvorsorge
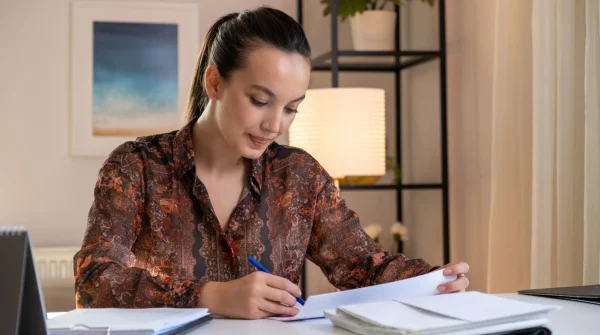
Absicherung und Vermögensaufbau in einem Vertrag: Kombinierte BU-Tarife bieten zusätzliche Vorteile, bergen aber auch Risiken. Wann sich die Kombination lohnt – und wann nicht – erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Bewegungsschmerzen, chronische Leiden, Unfälle – wenn der Körper nicht mehr mitspielt
Wenn der Körper nicht mehr mitmacht: körperliche Erkrankungen und Unfälle
Neben psychischen Erkrankungen zählen körperliche Beschwerden und Verletzungen zu den häufigsten Auslösern für eine Berufsunfähigkeit. Sie betreffen häufig ältere Menschen – können aber auch jüngere Arbeitnehmer treffen, etwa durch Unfälle oder dauerhafte Überlastung. Welche körperlichen Ursachen besonders oft zur Berufsunfähigkeit führen, zeigt dieser Abschnitt.
Erkrankungen des Bewegungsapparats – wie Rückenschmerzen, Arthrose oder Bandscheibenvorfälle – machen laut aktueller Statistik rund 19,38 % aller BU-Fälle in Deutschland aus. Sie entstehen oft durch körperlich belastende Tätigkeiten, Fehlhaltungen, mangelnde Bewegung oder degenerative Prozesse. Besonders betroffen sind Berufsgruppen mit dauerhaftem Heben, Tragen oder Arbeiten in Zwangshaltungen – etwa in Handwerk, Pflege, Industrie oder Logistik.
Was viele unterschätzen: Auch Bürojobs können langfristig Beschwerden hervorrufen – durch Bewegungsmangel, Stress oder unergonomische Arbeitsplätze. Ein unbehandeltes Rückenleiden kann so über Jahre hinweg zur vollständigen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit führen.
Krebserkrankungen sind mit 16–17 % der dritthäufigste Grund für eine Berufsunfähigkeit. Besonders bei Menschen über 50 treten bösartige Tumorerkrankungen häufiger auf – mit oft langwierigen Behandlungsphasen, Therapiefolgen und eingeschränkter Belastbarkeit. In vielen Fällen ist eine Rückkehr in den Beruf nicht möglich oder nur in Teilzeit denkbar.
Unfälle sind für rund 9 % der BU-Fälle verantwortlich, betreffen aber besonders häufig jüngere Menschen. Dazu zählen sowohl Verkehrsunfälle als auch Sport- oder Haushaltsunfälle. Ein Unfall kann zu plötzlicher Erwerbsunfähigkeit führen – z. B. durch Amputationen, Schädel-Hirn-Traumata oder Querschnittslähmung. Auch psychische Folgen wie ein posttraumatisches Belastungssyndrom können eine Rückkehr ins Berufsleben verhindern.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen und Stoffwechselstörungen wie Diabetes zählen zu den weiteren physischen Ursachen – sie treten gehäuft im höheren Alter auf. Aber auch genetische Faktoren, chronische Infektionen oder langjährige Gesundheitsbelastungen können Auslöser sein.
Wichtig: Körperliche Ursachen führen nicht nur zu vorübergehender Einschränkung, sondern oft zu langfristiger Arbeitsunfähigkeit. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung hilft in diesen Fällen, den Verdienstausfall auszugleichen und die Lebenshaltungskosten zu decken – unabhängig davon, ob die Beschwerden plötzlich oder schleichend entstanden sind.
Wenn der Körper streikt – körperliche Leiden und Unfälle als BU-Risiko
Wenn der Körper nicht mehr mitmacht: Physische Ursachen im Überblick
Körperliche Erkrankungen zählen neben psychischen Leiden zu den häufigsten Auslösern einer Berufsunfähigkeit. Dabei sind vor allem Rückenleiden, Gelenkprobleme und Krebserkrankungen von Bedeutung. Auch Unfälle – ob im Beruf oder in der Freizeit – führen nicht selten zu dauerhaften Einschränkungen. Was viele unterschätzen: Der Weg zurück in den Beruf bleibt Betroffenen oft dauerhaft verschlossen.
Statistisch gesehen sind rund 19 % aller BU-Leistungsfälle auf Erkrankungen des Bewegungsapparats zurückzuführen. Diese Zahlen spiegeln sich insbesondere bei Arbeitnehmern in körperlich belastenden Berufen wider – etwa auf dem Bau, in der Pflege, im Handwerk oder in der Logistik. Häufige Diagnosen sind Bandscheibenvorfälle, Arthrose, chronische Rückenschmerzen oder entzündliche Gelenkerkrankungen. Die Beschwerden führen häufig zu langanhaltender Arbeitsunfähigkeit, insbesondere wenn Umschulungen oder berufliche Alternativen fehlen.
Krebserkrankungen verursachen etwa 16–17 % der Berufsunfähigkeiten. Dabei handelt es sich oft um schwerwiegende Diagnosen mit langem Behandlungs- und Erholungsverlauf. Viele Patienten können nach einer Krebsbehandlung nicht wieder in ihre frühere Tätigkeit zurückkehren – sei es wegen körperlicher Einschränkungen, Fatigue-Syndrom oder psychischer Belastung. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter: Bei über 50-Jährigen zählt Krebs zu den drei häufigsten BU-Ursachen.
Unfälle sind zwar seltener als vermutet, spielen aber eine erhebliche Rolle. Mit rund 9 % Anteil an den BU-Fällen gehen sie meist mit plötzlichen, traumatischen Ereignissen einher: Verkehrsunfälle, Sportunfälle oder Stürze führen zu Verletzungen mit langfristigen Folgen – z. B. Lähmungen, Amputationen oder Schädel-Hirn-Traumata. Besonders gefährdet sind Menschen mit risikoreichen Hobbys oder Berufen, die hohe körperliche Anforderungen stellen.
Ein kritischer Punkt: Viele körperliche Leiden entwickeln sich über Jahre hinweg – begünstigt durch Fehlbelastungen, Bewegungsmangel oder beruflich bedingten Stress. Wer frühzeitig Prävention betreibt, z. B. durch Ergonomie am Arbeitsplatz, Bewegung und regelmäßige Check-ups, kann das Risiko deutlich senken. Dennoch bleibt die Gefahr real – vor allem für Berufstätige, die körperlich tätig sind oder lange Zeit unter hoher Belastung arbeiten.
BU-Versicherer berücksichtigen solche Risiken in ihrer Risikoeinschätzung – etwa durch Zuschläge bei vorgeschädigten Bandscheiben, eingeschränkten Bewegungsradien oder bestimmten Diagnosen im Bewegungsapparat. Wer betroffen ist, sollte eine anonyme Risikovoranfrage nutzen, um frühzeitig Klarheit über den Versicherbarkeit zu erhalten.
Zielgruppen & Fachwissen – weitere Inhalte passend zu Ihrer Lebenssituation
Berufsunfähigkeit verstehen – individuell, fundiert und praxisnah
Ob Schüler, Student oder Berufseinsteiger mit Vorerkrankung – die Anforderungen an eine gute Absicherung sind vielfältig. In diesen Beiträgen finden Sie spezielle Informationen für unterschiedliche Lebensphasen und erfahren mehr über wichtige Vertragsdetails rund um Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung.

BU-Versicherung für Schüler
Schon während der Schulzeit sinnvoll? Ja – denn der frühe Abschluss sichert günstige Beiträge und vollen Schutz für die Zukunft. Wir zeigen, worauf Eltern und Schüler achten sollten.

BU-Versicherung für Studenten
Studierende gelten oft als wenig gefährdet – doch psychische Erkrankungen und Leistungsdruck sprechen eine andere Sprache. Warum sich eine BU schon im Studium lohnt, lesen Sie hier.
Berufsunfähigkeit kennt kein Alter – aber unterschiedliche Risiken
BU-Risiko im Lebensverlauf: Wer ist besonders betroffen?
Ob Berufseinsteiger oder langjährige Fachkraft – das Risiko, berufsunfähig zu werden, begleitet Erwerbstätige in jeder Lebensphase. Doch die Ursachen und Eintrittswahrscheinlichkeiten verändern sich mit dem Alter deutlich. Während bei Jüngeren psychische Belastungen dominieren, steigt bei Älteren die Zahl der körperlich bedingten BU-Fälle stark an. Ein Blick auf die Altersstatistik hilft dabei, die persönliche Risikosituation realistisch einzuschätzen.
Die Analyse der aktuellen Leistungsstatistiken zeigt deutlich: Das Eintrittsalter für eine Berufsunfähigkeit liegt im Durchschnitt zwischen 44 und 47 Jahren – und damit weit vor dem eigentlichen Rentenalter. Die Ursachen verschieben sich dabei mit zunehmendem Alter: Psychische Erkrankungen überwiegen bei jüngeren Menschen, insbesondere im Alter zwischen 25 und 40 Jahren. Häufig sind diese auf beruflichen Druck, private Belastungen oder fehlende psychische Stabilität zurückzuführen.
Ab dem mittleren Erwerbsalter gewinnen hingegen körperliche Ursachen deutlich an Relevanz. Erkrankungen wie Arthrose, Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes oder Krebserkrankungen treten häufiger auf und führen vermehrt zu längerer oder dauerhafter Berufsunfähigkeit. Die M&M‑Studie zeigt, dass ab 50 Jahren die Wahrscheinlichkeit für eine körperlich bedingte BU rapide ansteigt. Besonders betroffen sind Menschen mit langjähriger Belastung im Beruf, einseitiger körperlicher Tätigkeit oder bereits bestehenden Vorerkrankungen.
Auch das Geschlecht hat Einfluss auf das statistische Risiko: Während Frauen unter 40 deutlich häufiger an psychischen Ursachen berufsunfähig werden, zeigt sich bei Männern im höheren Alter eine Häufung körperlich bedingter BU-Fälle. Diese Unterschiede spielen bei der Risikoeinschätzung vieler Versicherer eine zentrale Rolle.
Wichtig: Die Gefahr, berufsunfähig zu werden, beginnt nicht erst im fortgeschrittenen Alter. Auch Berufseinsteiger oder Auszubildende können betroffen sein – etwa durch Depressionen, schwere Unfälle oder angeborene Erkrankungen. Dennoch sichern sich viele junge Erwachsene erst spät ab – häufig aus Unkenntnis oder dem Gefühl, „nicht zur Risikogruppe“ zu gehören. Dabei ist gerade in jungen Jahren die Beitragskalkulation besonders günstig, da das individuelle Gesundheitsrisiko noch vergleichsweise niedrig ist.
Fazit: Das BU-Risiko ist keine Frage des Alters, sondern des individuellen Gesundheitsverlaufs, der beruflichen Belastung und des Lebensstils. Wer sich frühzeitig absichert, profitiert doppelt: durch niedrige Beiträge und durch Schutz in der Lebensphase mit zunehmenden Risiken.
Zeitraum, Zahlungen und Realität im Leistungsfall
Wie lange dauert eine Berufsunfähigkeit – und was zahlt der Versicherer?
Wer berufsunfähig wird, ist nicht für Wochen außer Gefecht – sondern meist für Jahre. Die durchschnittliche Dauer liegt laut Statistik bei rund sechs bis sieben Jahren. Auch der Weg zur ersten BU-Rente ist nicht sofort abgeschlossen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie lange Betroffene auf Leistungen warten, wie lange diese gezahlt werden und welche Rolle eine sorgfältige Antragstellung spielt.
Die Vorstellung, dass eine Berufsunfähigkeit nur wenige Monate andauert, ist ein Irrglaube. Laut den aktuellen Auswertungen von M&M und GDV beträgt die durchschnittliche Leistungsdauer einer BU-Rente rund sechs Jahre, in vielen Fällen deutlich länger. Bei chronischen Erkrankungen – ob psychisch oder körperlich bedingt – erhalten Versicherte oft zehn Jahre oder mehr Zahlungen.
Der Weg zur ersten Auszahlung ist dabei mit Geduld verbunden. Laut GDV und Branchenreports vergehen durchschnittlich 160 bis 180 Tage (ca. fünf bis sechs Monate) zwischen der Antragstellung und der ersten Rentenzahlung. Grund sind unter anderem ärztliche Gutachten, Rückfragen der Versicherer sowie die Prüfung des BU-Grads. Wichtig: Wer alle Unterlagen vollständig und nachvollziehbar einreicht, kann diesen Zeitraum deutlich verkürzen.
Während der Leistungsphase finden regelmäßige Nachprüfungen statt – in der Regel einmal jährlich. Hier prüfen die Versicherer, ob die Berufsunfähigkeit weiterhin besteht oder sich der Gesundheitszustand verbessert hat. Wird die Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt, endet die Rentenzahlung, es sei denn, der vertraglich vereinbarte Zeitraum läuft unabhängig davon weiter.
Die Rentenhöhe selbst ist individuell vereinbart, orientiert sich aber idealerweise an etwa 70 bis 80 % des bisherigen Nettoeinkommens. Bei einem zu niedrigen Rentenbetrag kann es trotz BU-Absicherung zu finanziellen Engpässen kommen – insbesondere, wenn zusätzliche Ausgaben für medizinische Behandlung, Umstellungen im Alltag oder Rehabilitationsmaßnahmen anfallen.
Ein weiterer Aspekt: Die meisten BU-Renten enden mit dem Erreichen des vertraglich festgelegten Endalters, häufig dem 65. oder 67. Lebensjahr. In Einzelfällen kann die Leistung früher enden – etwa bei Tod der versicherten Person oder bei Aufnahme einer neuen beruflichen Tätigkeit mit vergleichbarem Einkommen.
Fazit: Die finanzielle Realität im BU-Fall wird oft unterschätzt. Ohne passende Absicherung steht Betroffenen schnell das wirtschaftliche Aus bevor. Wer frühzeitig eine realistische Rentenhöhe festlegt, Karenzzeiten minimiert und auf eine professionelle Antragstellung achtet, sorgt für finanzielle Stabilität – genau dann, wenn sie am dringendsten gebraucht wird.
Hier finden Sie Antworten auf Fragen, die häufig im Zusammenhang mit BU-Zahlen und Risiken gestellt werden
Was Sie schon immer über Berufsunfähigkeits‑Statistiken wissen wollten
Gibt es starke Unterschiede im BU-Risiko je nach Branche?
Ja. Statistiken zeigen, dass körperlich belastete Berufsgruppen (z. B. Handwerk, Pflege) häufiger Berufsunfähigkeit erleiden als Bürojobs. Psychische Erkrankungen dagegen finden sich branchenübergreifend – insbesondere bei stresssensiblen Berufen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, schon unter 30 berufsunfähig zu werden?
Die Eintrittswahrscheinlichkeit bis zum 30. Lebensjahr liegt zwar deutlich unter dem Durchschnitt, kann sich aber bei psychischen Erkrankungen oder Unfällen auf 2–3 % belaufen – insbesondere bei Studierenden oder Berufseinsteigern mit hoher Stressbelastung.
Nehmen BU-Fälle wegen psychischer Erkrankungen weiterhin zu?
Ja. Laut M&M‑Statistiken ist der Anteil psychischer Ursachen in den letzten Jahren um über 30 % gestiegen – allein bei unter 40-Jährigen. Fachleute führen das auf beruflichen Druck, soziale Veränderungen und Stigmatisierungsabbau zurück.
Führen technischer Fortschritt und Gesundheitstrends zu sinkenden körperlichen BU-Fällen?
Langfristig ja – aber der Effekt ist gering. Zwar kann Ergonomie am Arbeitsplatz Rückenerkrankungen senken, doch der aktuelle Anteil von 18–20 % an BU-Leistungen bleibt stabil – deutlicher Rückgang ist statistisch noch nicht zu sehen.
Wie realistisch ist es, nach einer BU wieder in den Beruf einzusteigen?
Nur selten. Nur etwa 20–25 % der Betroffenen kehren innerhalb von fünf Jahren nach der BU zurück in ihren zuletzt ausgeübten Beruf. Mehr als 50 % bleiben langfristig auf Leistungen angewiesen – vor allem bei psychischen oder schwerwiegenden physischen Erkrankungen.
Gibt es statistische Hinweise auf regionale Unterschiede?
Ja, wenn auch moderat. Daten zeigen leicht erhöhte BU-Fälle in Regionen mit höherer körperlicher Beschäftigung (z. B. ländlich, Industriegebiete). Insgesamt dominieren jedoch individuelle Gesundheits- und Lebensstilfaktoren.
Wie zuverlässig sind diese Zahlen – auf welchen Studien basieren sie?
Die hier präsentierten Daten beruhen auf verlässlichen Studien und Versicherungsstatistiken, etwa:
M&M Marktblick Berufsunfähigkeit 2025 (basierend u. a. auf April‑2024‑Grafiken)
GDV-Fakten zur BU
LV 1871‑Statistik zur Berufsunfähigkeit
Diese Quellen sind praxisbasiert, aktuell und an realen Leistungsfällen orientiert.
Zusammenfassung
Fast jeder vierte Angestellte und jeder dritte Arbeiter in Deutschland wird im Laufe seines Erwerbslebens berufsunfähig. Die häufigsten Ursachen sind psychische Erkrankungen, gefolgt von Rückenproblemen, Krebserkrankungen und Unfällen. Besonders jüngere Erwachsene sind stark durch psychische Belastungen gefährdet, während bei Älteren körperliche Leiden überwiegen. Die durchschnittliche Leistungsdauer liegt bei rund sechs Jahren – mit einer Wartezeit von bis zu 180 Tagen bis zur ersten Auszahlung.
Wer frühzeitig vorsorgt, profitiert doppelt: durch günstigere Beiträge und die Sicherheit, im Ernstfall finanziell abgesichert zu sein. Statistische Auswertungen helfen nicht nur beim Verstehen des Risikos – sondern auch bei der individuellen Entscheidungsfindung. Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre persönliche Absicherungsstrategie.
häufige Fragen
Wie hoch ist die Berufsunfähigkeitsquote in Deutschland?
Statistisch wird rund jeder vierte Angestellte und etwa jeder dritte Arbeiter bis zum Renteneintritt berufsunfähig. Die Quote liegt laut GDV je nach Beruf und Alter bei 25–30 %.
Welches Eintrittsalter ist bei Berufsunfähigkeit am häufigsten?
Die meisten BU-Fälle treten zwischen dem 44. und 47. Lebensjahr auf. Psychische Erkrankungen führen bei vielen bereits im Alter von 30–40 Jahren zur Berufsunfähigkeit.
Wie lange dauert eine durchschnittliche BU-Leistung?
Im Schnitt werden BU-Leistungen über einen Zeitraum von 6–7 Jahren gezahlt. In manchen Fällen – insbesondere bei chronischen Erkrankungen – deutlich länger.
Wie hoch ist die Ablehnungsquote bei BU-Anträgen?
Rund 18–21 % der BU-Anträge werden abgelehnt. Hauptgründe sind unvollständige Angaben im Antrag oder das Nichterreichen des erforderlichen BU-Grads von 50 %.

