Gliedertaxe in der Unfallversicherung – So wird der Schaden bewertet
Die Gliedertaxe bestimmt, wie viel Geld Sie im Invaliditätsfall erhalten. Wir erklären, welche Körperteile wie bewertet werden – mit Beispielen

Wenn es durch einen Unfall zu dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen kommt, stellt sich schnell eine entscheidende Frage: Wie viel zahlt die Unfallversicherung – und nach welchen Regeln? Die Antwort liegt in der sogenannten Gliedertaxe. Sie definiert, wie stark ein Körperteil bewertet wird und welchen Anteil der vereinbarten Versicherungssumme Sie erhalten. Doch nicht jede Gliedertaxe ist gleich. Je nach Tarif und Versicherer gibt es erhebliche Unterschiede in der Bewertung. Wir zeigen Ihnen, wie die Gliedertaxe funktioniert, wie der Invaliditätsgrad ermittelt wird und worauf Sie bei der Wahl Ihrer Unfallversicherung unbedingt achten sollten.
Das Wichtigste auf einem Blick
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
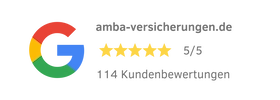
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Verstehen, berechnen, vergleichen – was Sie zur Gliedertaxe wissen müssen.
So funktioniert die Gliedertaxe – Aufbau, Bewertung und Rechenbeispiele
Die Gliedertaxe ist das Herzstück der privaten Unfallversicherung. Sie entscheidet, wie stark ein Unfall die finanzielle Leistung beeinflusst – und ob Sie im Ernstfall wirklich abgesichert sind. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, wie die Gliedertaxe aufgebaut ist, wie der Invaliditätsgrad berechnet wird und welche Summen bei typischen Verletzungen ausgezahlt werden. Die folgenden Tabs führen Sie durch die wichtigsten Aspekte.
Die Gliedertaxe ist eine fest definierte Tabelle, die jedem Körperteil oder Sinnesorgan einen prozentualen Invaliditätswert zuordnet. Grundlage ist die Annahme, dass bestimmte Körperfunktionen für die allgemeine Leistungsfähigkeit eines Menschen unterschiedlich wichtig sind. Je nach Versicherungsgesellschaft können die Werte leicht variieren, der grundsätzliche Aufbau bleibt jedoch gleich.
Beispiele für typische Werte:
Verlust eines Arms: 70 %
Verlust einer Hand: 55 %
Verlust eines Beins: 70 %
Verlust eines Auges: 50 %
Verlust eines Daumens: 20 %
Diese Prozentwerte gelten jeweils für den vollständigen Verlust. Liegt eine teilweise Beeinträchtigung vor, wird der Invaliditätsgrad anteilig anhand eines ärztlichen Gutachtens ermittelt.
Wichtig: Die Gliedertaxe unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Daher ist ein genauer Tarifvergleich unverzichtbar, um im Ernstfall keine finanziellen Nachteile zu erleiden.
Der Invaliditätsgrad ist die Grundlage für die Berechnung Ihrer Entschädigung nach einem Unfall. Er wird auf Basis der Gliedertaxe und eines medizinischen Gutachtens ermittelt. Dabei gilt: Je höher der Invaliditätsgrad, desto höher die Auszahlung.
So funktioniert die Berechnung:
Der behandelnde Arzt beurteilt die bleibende Beeinträchtigung eines Körperteils.
Die Beeinträchtigung wird in Relation zum in der Gliedertaxe festgelegten Wert gesetzt.
Die so ermittelte Prozentzahl ergibt den Invaliditätsgrad.
Die Versicherung zahlt den entsprechenden Anteil der vereinbarten Versicherungssumme aus.
Wird beispielsweise der rechte Arm nur zu 50 % beeinträchtigt und in der Gliedertaxe mit 70 % bewertet, ergibt das einen Invaliditätsgrad von 35 %.
Tipp: Einige Tarife bieten bereits ab 1 % Invaliditätsgrad eine Leistung – andere erst ab 20 %. Prüfen Sie dies unbedingt vor Vertragsabschluss.
Praxisbeispiele machen deutlich, wie groß die Unterschiede in der Auszahlung je nach Invaliditätsgrad und Progression sein können. Grundlage ist dabei die vereinbarte Versicherungssumme – beispielsweise 100.000 €.
Beispiel 1:
Eine Amputation des linken Beins (Gliedertaxe: 70 %) führt zu einer Auszahlung von 70.000 €. Bei einer Progression von 350 % erhöht sich der Betrag je nach Staffelung deutlich – auf rund 130.000 €.
Beispiel 2:
Ein Daumenverlust (20 %) ergibt bei einer Grundsumme von 100.000 € eine Auszahlung von 20.000 €. Mit 500 % Progression und einem Invaliditätsgrad von 60 % steigt der Betrag auf bis zu 200.000 €.
Beispiel 3:
Mehrere Verletzungen, z. B. Verlust eines Auges (50 %) und eines Fingers (10 %), führen zu einer Gesamtinvalidität von 60 %. Die Auszahlung beträgt ohne Progression 60.000 €, mit Progression deutlich mehr – abhängig vom gewählten Tarif.
Diese Beispiele zeigen, wie stark sich die Kombination aus Gliedertaxe, Invaliditätsgrad und Progression auf die tatsächliche Leistung auswirkt.
Warum Progression Ihre Leistung vervielfachen kann – besonders bei schweren Unfällen.
Progression in der Unfallversicherung – So sichern Sie sich höhere Auszahlungen
Die Progression ist ein Zusatzbaustein in der privaten Unfallversicherung, der bei schweren Verletzungen entscheidend sein kann. Sie sorgt dafür, dass die Auszahlung bei höherem Invaliditätsgrad überproportional ansteigt. Wer also eine schwere Beeinträchtigung erleidet, erhält ein Vielfaches der vereinbarten Grundsumme. Doch nicht jede Progressionsstaffel ist gleich – und auch hier lohnt sich ein genauer Blick.
Mit der Progression wird der finanzielle Schutz bei schweren Unfällen erheblich verstärkt. Während bei leichten Beeinträchtigungen die Auszahlung linear zur Versicherungssumme erfolgt, greift die Progression ab einem festgelegten Invaliditätsgrad – meist ab 25 % – und vervielfacht die Leistung.
Die Höhe der Progression lässt sich bei Vertragsabschluss individuell wählen. Gängige Stufen sind 225 %, 350 % oder 500 %. Einige Versicherer bieten sogar eine Progression bis 1.000 % an. Die Staffelung bestimmt, wie stark die Leistung bei steigender Invalidität anwächst.
Beispiel:
Bei einem Invaliditätsgrad von 70 % und einer Versicherungssumme von 100.000 € ergibt sich mit 500 % Progression eine Auszahlung von rund 290.000 €. Ohne Progression wären es lediglich 70.000 €.
Die Progression wird in jeder Police mit einer eigenen Tabelle abgebildet. Dort erkennen Sie, wie viel Geld bei welchem Invaliditätsgrad gezahlt wird. Besonders wichtig: Je höher die gewählte Progression, desto stärker profitieren Sie bei schweren Unfallfolgen – gleichzeitig steigen aber auch die Beiträge.
Für viele Versicherte ist eine Progression von 350 % oder 500 % sinnvoll, da sie einen guten Mittelweg zwischen Beitrag und Leistung bietet. Gerade Familien, Selbstständige oder körperlich aktive Menschen sollten diesen Baustein nicht vernachlässigen.
Wie viel Absicherung brauchen Sie wirklich? So finden Sie die passende Versicherungssumme.
Die richtige Versicherungssumme – Grundlage für Ihre finanzielle Sicherheit nach einem Unfall
Die Versicherungssumme bildet die Basis jeder Unfallversicherung. Sie entscheidet darüber, wie hoch Ihre Auszahlung im Schadensfall ausfällt. Wer hier zu niedrig ansetzt, riskiert im Ernstfall große finanzielle Lücken – selbst bei hoher Progression. Wir zeigen, wie Sie die optimale Summe für Ihre Lebenssituation berechnen.
Die Grundversicherungssumme – oft auch Invaliditätsgrundsumme genannt – ist der zentrale Wert, von dem sämtliche Leistungen der Unfallversicherung abhängen. Sie legt fest, wie viel Geld Sie bei einem Invaliditätsgrad von 100 % erhalten. Von diesem Wert aus wird die anteilige Auszahlung für jede Beeinträchtigung berechnet – ergänzt durch die gewählte Progression.
Als Faustregel empfiehlt sich:
Bis 30 Jahre: das Sechsfache des Bruttojahreseinkommens
Bis 40 Jahre: das Fünffache
Ab 50 Jahren: das Vierfache
Mindestempfehlung: immer mindestens 100.000 €, besser 150.000–200.000 €, abhängig von Beruf, Lebensstandard und familiären Verpflichtungen
Die Wahl der Versicherungssumme hängt aber nicht nur vom Einkommen ab, sondern auch vom persönlichen Risiko. Körperlich aktive Menschen, Eltern oder Selbstständige sollten eine höhere Absicherung wählen. Auch die geplante Progression beeinflusst die Grundsumme: Wer eine hohe Progression (z. B. 500 %) nutzt, kann eine geringere Grundsumme wählen, ohne auf Leistungsstärke zu verzichten – dafür zahlt man jedoch mehr Beitrag.
Unser Tipp: Lassen Sie sich professionell beraten und prüfen Sie Ihre Lebenssituation realistisch. Nur so stellen Sie sicher, dass die Versicherungssumme im Fall der Fälle wirklich ausreicht, um Umbaukosten, Verdienstausfälle oder notwendige Umstellungen zu finanzieren.
Vertiefende Themen rund um Ihre Unfallversicherung – gezielt für Ihre Lebenssituation.
Weitere passende Themen zur Unfallversicherung entdecken
Die Gliedertaxe ist nur ein Baustein im System der privaten Unfallversicherung. Je nach Lebenslage gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen – etwa für Familien, Kinder oder handwerklich Tätige. Die folgenden Themen führen Sie gezielt weiter, wenn Sie sich umfassender absichern möchten.
Kinder-Unfallversicherung

Kinder können keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen – umso wichtiger ist ein zuverlässiger Unfallschutz. Erfahren Sie, welche Leistungen bei Unfällen auf dem Spielplatz, in der Schule oder im Straßenverkehr wichtig sind und worauf Sie beim Abschluss achten sollten.
Familienunfallversicherung

Wer seine Familie absichern will, braucht individuelle Lösungen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Partner und Kinder gemeinsam schützen, welche Leistungen sinnvoll sind und worauf Familien beim Vergleich der Unfallversicherungen besonders achten sollten.
Unfallversicherung für Bauhelfer

Auf der Baustelle drohen täglich neue Risiken – gerade für private Bauhelfer. Wir erklären, wie Sie sich oder Ihre Helfer während der Bauphase korrekt absichern und welche Besonderheiten bei der Unfallversicherung für Bauhelfer gelten.
Was gilt bei Verletzungen, die in der Gliedertaxe nicht explizit aufgeführt sind?
Spezialfälle in der Gliedertaxe – So wird bei nicht gelisteten Körperteilen entschieden
Nicht jede Verletzung lässt sich direkt einem festen Wert in der Gliedertaxe zuordnen. Was passiert, wenn ein Körperteil fehlt oder die Beeinträchtigung komplexer ist? In solchen Fällen greift ein medizinisches Gutachten – und das kann je nach Versicherung stark unterschiedliche Folgen haben.
Die Gliedertaxe ist eine standardisierte Tabelle, doch sie kann nicht alle körperlichen Besonderheiten oder Verletzungsmuster erfassen. Für Körperteile oder Sinnesorgane, die nicht explizit in der Tabelle gelistet sind – wie z. B. Schulter, Wirbelsäule oder Sprachfähigkeit – wird der Invaliditätsgrad individuell durch ein ärztliches Gutachten bestimmt.
Das ärztliche Gutachten bewertet die Einschränkung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu einer gesunden Durchschnittsperson gleichen Alters. Dabei kommt es nicht nur auf die Art der Verletzung an, sondern vor allem auf deren Auswirkungen im Alltag.
Beispiel: Eine dauerhafte Bewegungseinschränkung der Schulter nach einem Unfall wird nicht direkt über die Gliedertaxe geregelt. Der Arzt schätzt den Einfluss dieser Beeinträchtigung auf Ihre allgemeine Leistungsfähigkeit ein – etwa im Beruf oder bei alltäglichen Aufgaben – und schlägt auf dieser Basis einen Invaliditätsgrad vor.
Besonderheiten:
Der Versicherer kann das Gutachten prüfen und bei Bedarf ein weiteres verlangen.
Die Bewertung kann je nach Versicherer unterschiedlich ausfallen.
Bei sehr geringen Invaliditätsgraden (z. B. 1–5 %) leisten nur wenige Tarife – prüfen Sie Ihre Police genau.
Unser Rat: Achten Sie beim Abschluss der Unfallversicherung darauf, dass auch untypische Verletzungen klar geregelt sind – oder eine niedrige Mindestinvalidität (z. B. ab 1 %) versichert ist. Denn gerade in diesen Spezialfällen entscheidet der Tarif über Leistung oder Ablehnung.
Zwei Policen, zwei Schutzbereiche – warum beide Absicherungen wichtig sein können.
Unfallversicherung und Berufsunfähigkeit – getrennt, aber sinnvoll kombinierbar
Die private Unfallversicherung schützt Sie bei dauerhaften Schäden durch einen Unfall. Die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet bei krankheits- oder unfallbedingtem Verlust der Arbeitskraft. Zwei eigenständige Policen – mit unterschiedlichen Leistungen und Zielsetzungen. Richtig eingesetzt, ergänzen sie sich wirkungsvoll.
Unfallversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung sind zwei eigenständige Versicherungsverträge – mit klar abgegrenzten Aufgaben: Die Unfallversicherung zahlt bei körperlichen Dauerfolgen durch einen Unfall, meist in Form einer einmaligen Kapitalleistung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung hingegen leistet eine monatliche Rente, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen – ob durch Unfall oder Krankheit – nicht mehr in Ihrem Beruf arbeiten können.
Die Kombination beider Policen ist deshalb sinnvoll, weil sie unterschiedliche Lebensbereiche absichern:
Die Unfallversicherung greift schnell, oft schon ab 1 % Invalidität, und hilft bei Umbauten, Mobilitätshilfen oder Einkommensausfällen nach einem Unfall.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung sichert den langfristigen Verdienstausfall – unabhängig von der Ursache.
Gerade weil Krankheiten wie psychische Leiden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs häufig zur Berufsunfähigkeit führen, reicht eine Unfallversicherung allein nicht aus. Umgekehrt schützt eine BU-Versicherung nicht vor den finanziellen Folgen eines schweren Unfalls, wenn keine Berufsunfähigkeit eintritt.
Wichtig: Es handelt sich nicht um eine Kombipolice. Beide Verträge müssen separat abgeschlossen und aufeinander abgestimmt werden. Wer clever plant, sorgt mit beiden Policen für umfassenden Schutz – abgestimmt auf Alter, Beruf und Lebenssituation.
Vertiefen Sie Ihr Wissen – rund um Leistungen, Kosten und Auszahlungsbeispiele.
Weitere Themen, die für Ihre Unfallversicherung entscheidend sein können
Wie hoch sind die Kosten für eine private Unfallversicherung? Welche Summen werden bei typischen Verletzungen gezahlt? Und was müssen Sie bei Abschluss und Leistungserhalt beachten? Die folgenden Themen geben Ihnen wertvolle Einblicke in besonders häufige Fragen und Entscheidungskriterien.

Kosten der Unfallversicherung
Wie teuer ist guter Unfallschutz wirklich? Wir zeigen Ihnen, welche Faktoren den Beitrag beeinflussen – vom Alter über die Gefahrengruppe bis hin zur Progression. Mit Rechenbeispielen für verschiedene Lebenssituationen.

Auszahlung bei Invalidität
Invalidität, Gliedertaxe, Progression – wir erklären an konkreten Beispielen, wie hoch die Auszahlung im Ernstfall ausfällt und worauf es bei der Tarifwahl ankommt.
Häufig übersehene Fragen – verständlich und konkret beantwortet.
Was Sie schon immer über die Gliedertaxe wissen wollten
Warum unterscheiden sich die Gliedertaxen je nach Versicherer?
Die Gliedertaxe ist nicht gesetzlich einheitlich geregelt. Jeder Versicherer legt in seinen Bedingungen selbst fest, wie einzelne Körperteile bewertet werden. So kann der Verlust eines Daumens bei Anbieter A mit 20 %, bei Anbieter B mit 25 % angesetzt sein. Deshalb ist ein Vergleich der Tarifbedingungen entscheidend, bevor Sie eine Police abschließen.
Wird auch gezahlt, wenn der Körperteil nicht ganz verloren geht, sondern nur eingeschränkt nutzbar ist?
Ja. Bei einer teilweisen Beeinträchtigung wird der Invaliditätsgrad anteilig berechnet. Grundlage ist dabei das ärztliche Gutachten. Beispiel: Ist die Hand nur noch zur Hälfte funktionsfähig, wird die Hälfte des Gliedertaxewerts (z. B. 55 % → 27,5 %) angesetzt.
Kann ich als Linkshänder eine höhere Entschädigung erwarten, wenn meine dominante Hand betroffen ist?
Einige Versicherer unterscheiden in ihren Bedingungen zwischen rechter und linker Hand – insbesondere bei Rechtshändern. Für Linkshänder kann eine abweichende Bewertung gelten, sofern die dominante Hand betroffen ist. Das muss vertraglich geregelt sein. In vielen Tarifen wird aber pauschal bewertet – unabhängig von der Händigkeit.
Was passiert, wenn mehrere Körperteile verletzt sind?
In diesem Fall werden die Invaliditätsgrade addiert – maximal bis 100 %. Bei sehr schweren Unfällen mit mehreren betroffenen Körperbereichen können hohe Gesamtgrade erreicht werden. Die gewählte Progression beeinflusst hier die Höhe der Auszahlung entscheidend.
Leistet die Unfallversicherung auch bei psychischen Folgen?
Nein. Die Gliedertaxe bezieht sich ausschließlich auf körperliche oder sinnliche Beeinträchtigungen. Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen sind nicht über die Unfallversicherung abgedeckt – selbst wenn sie unfallbedingt sind. Hier greift ausschließlich die Berufsunfähigkeitsversicherung.
Gibt es eine Leistung auch bei leichten Verletzungen mit nur 1–5 % Invaliditätsgrad?
Das hängt vom Tarif ab. Gute Unfallversicherungen leisten bereits ab 1 % Invaliditätsgrad. Andere zahlen erst ab 20 %. Achten Sie auf die Mindestinvalidität in den Versicherungsbedingungen – gerade für Alltagsverletzungen kann das den Unterschied machen.
Zusammenfassung
Die Gliedertaxe legt fest, wie stark bestimmte Körperteile bei einer dauerhaften Beeinträchtigung bewertet werden – und bestimmt damit maßgeblich die Höhe Ihrer Entschädigung nach einem Unfall. Jeder Versicherer verwendet eigene Tabellen und Bewertungsmaßstäbe. Umso wichtiger ist es, Tarife zu vergleichen und auf Mindestinvalidität, Progression und Versicherungssumme zu achten. Die Gliedertaxe kann für einfache wie komplexe Verletzungen genutzt werden, vorausgesetzt, die Beeinträchtigung ist medizinisch objektivierbar. Wer umfassend vorsorgt, sollte außerdem über eine ergänzende Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken – als separate Police für den langfristigen Einkommensschutz.
häufige Fragen
Wie wird die Gliedertaxe in der Unfallversicherung angewendet?
Jeder Körperteil ist mit einem festen Prozentsatz versehen. Nach einem Unfall wird anhand ärztlicher Gutachten festgestellt, wie stark der Körperteil dauerhaft beeinträchtigt ist. Daraus ergibt sich der Invaliditätsgrad, der die Auszahlung bestimmt.
Welche Versicherungssumme sollte ich bei Gliedertaxe wählen?
Empfohlen wird das Vier- bis Sechsfache Ihres Bruttojahreseinkommens. Die passende Summe hängt von Alter, Beruf und Lebensstil ab – und davon, ob Sie zusätzlich eine hohe Progression wählen.
Gilt die Gliedertaxe auch für Kinder?
Ja. Kinder-Unfallversicherungen enthalten ebenfalls eine Gliedertaxe. Sie dient auch hier der Berechnung der Invaliditätsleistung – z. B. nach Verletzungen beim Spielen, in der Schule oder im Straßenverkehr.
Was passiert bei Verletzungen, die nicht in der Gliedertaxe aufgeführt sind?
In diesem Fall entscheidet ein ärztliches Gutachten über den Invaliditätsgrad. Die Versicherung prüft dann individuell, wie stark die dauerhafte Einschränkung die körperliche Leistungsfähigkeit mindert.

