Gebäudeversicherung bei Leerstand – was ist zu beachten?
Steht ein Gebäude leer, gelten besondere Regeln – wir zeigen, wie Versicherungsschutz erhalten bleibt und welche Risiken entstehen

Ein leerstehendes Haus bedeutet mehr als nur ungenutzter Wohnraum – es kann schnell zum finanziellen Risiko werden. Ob nach einem Umzug, während einer Sanierung oder aufgrund fehlender Mieter: Sobald Ihre Immobilie längere Zeit unbewohnt ist, ändern sich auch die Spielregeln der Wohngebäudeversicherung. Doch welche Meldepflichten gelten? Welche Schäden sind besonders häufig? Und was droht, wenn der Leerstand nicht gemeldet wird? Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt – und wie Sie sich optimal absichern.
Das Wichtigste auf einem Blick
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
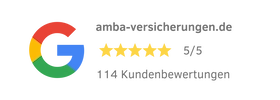
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne

Was bedeutet Leerstand – und warum interessiert das die Versicherung?
Ein Gebäude gilt als „leerstehend“, wenn es nicht bewohnt, nicht genutzt und auch nicht regelmäßig betreut wird – etwa während einer längeren Sanierung, nach einem Umzug oder bei Vermietungslücken. Für Versicherer ist das ein kritischer Risikofaktor, denn:
Ein leerstehendes Haus wird nicht geheizt, nicht gelüftet, nicht gewartet – Schäden bleiben oft lange unentdeckt.
Und genau das ist der Knackpunkt:
Wasserrohrbrüche, Frostschäden, Vandalismus oder Einbruch – all das tritt bei leerstehenden Gebäuden häufiger auf und wird meist erst spät bemerkt. Deshalb gilt Leerstand als gefahrerhöhend – mit rechtlichen Folgen.
Wer den Leerstand nicht meldet, riskiert im Ernstfall den Versicherungsschutz.
In vielen Tarifen gelten bereits nach 60 Tagen andere Bedingungen – oder es drohen Ausschlüsse und Beitragserhöhungen.
Warum Immobilien leer stehen – und was dahintersteckt
Gründe für Leerstand bei Wohngebäuden
Leerstand entsteht nicht zufällig – oft sind es strukturelle, wirtschaftliche oder persönliche Gründe, die dazu führen, dass ein Haus oder eine Wohnung längere Zeit ungenutzt bleibt. Diese Ursachen wirken sich direkt auf die Versicherbarkeit und das Risiko aus.
Spekulation & Marktverzerrung
Einige Eigentümer halten ihre Immobilien bewusst leer, um auf Wertsteigerungen zu spekulieren – etwa in stark nachgefragten Stadtlagen. Diese Strategie kann sich langfristig auszahlen, bringt aber zusätzliche Risiken durch fehlende Nutzung und Überwachung mit sich.
Sanierungsstau
Hohe Modernisierungskosten schrecken viele Eigentümer ab, besonders bei Altbauten. Bleibt die Sanierung aus, steht das Haus leer – oft über Monate oder Jahre. Schäden am Dach, an Leitungen oder an der Substanz bleiben dabei häufig unentdeckt.
Demografischer Wandel
In ländlichen Regionen führt der Wegzug junger Menschen zu dauerhaftem Leerstand. Häuser verlieren an Wert, weil sich keine Mieter oder Käufer finden – besonders problematisch für geerbte oder geerbte, sanierungsbedürftige Gebäude.
Die Gründe für Leerstand sind vielfältig – und jedes Szenario bringt eigene Risiken mit sich. Vor allem Sanierungsstau ist in Deutschland ein häufiges Problem: Eigentümer können oder wollen nicht in neue Fenster, Dämmung oder Heizsysteme investieren, was zur Aufgabe der Immobilie führt.
Ein zweiter häufiger Grund ist Immobilienspekulation – insbesondere in Ballungsräumen. Dort werden Wohnungen gezielt zurückgehalten, um später teurer zu verkaufen oder zu vermieten. Für Versicherer stellt dies ein Problem dar, da diese leerstehenden Immobilien oft nicht ordnungsgemäß betreut werden.
Auch demografische Effekte sind nicht zu unterschätzen: In ländlichen Gebieten führt Abwanderung zu sinkender Nachfrage. Das Resultat: ganze Straßenzüge mit leerstehenden Häusern, die über Jahre hinweg unbeaufsichtigt bleiben.
In allen Fällen verschärft sich das Risiko für Vandalismus, technische Defekte und Brandstiftung – und genau das erhöht die Anforderungen an den Versicherungsschutz.
Wenn Kontrolle fehlt, steigen die Gefahren
Typische Risiken bei leerstehenden Gebäuden
Ein leerstehendes Haus ist mehr als nur ungenutzt – es ist ungeschützt. Ohne regelmäßige Kontrolle drohen Schäden, die teuer werden können – oft, bevor sie überhaupt bemerkt werden.
Leerstehende Immobilien sind besonders anfällig für eine Vielzahl von Risiken – und genau das macht sie für Versicherer zur Herausforderung. Besonders häufig treten drei Schadensarten auf:
Witterungsbedingte Schäden:
Frost, Sturm und Starkregen führen bei leerstehenden Gebäuden überdurchschnittlich oft zu Folgeschäden. Nicht entleerte Wasserleitungen können bei Frost platzen, Dächer werden durch lose Ziegel zur Gefahrenquelle, und bei fehlender Dämmung droht Schimmelbildung. Diese Schäden bleiben häufig unentdeckt, bis die Reparaturkosten hoch sind – und können bei versäumten Sicherungsmaßnahmen sogar vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sein.Sicherheitsrisiken:
Einbruch, Diebstahl und Vandalismus sind bei leerstehenden Gebäuden ein akutes Problem. Laut Polizei-Statistik steigt das Einbruchsrisiko bei unbewohnten Objekten deutlich an – vor allem dann, wenn keine sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Brandstiftung durch Eindringlinge ist eine weitere ernsthafte Gefahr.Technische Defekte:
Heizungen, elektrische Anlagen und wasserführende Systeme müssen regelmäßig gewartet werden. Fehlt diese Wartung, drohen teure technische Schäden – z. B. durch Leckagen, Korrosion oder Kurzschlüsse. Besonders kritisch: Undichte Wasserleitungen, die unbemerkt Wände und Böden durchfeuchten.
Viele Versicherer verlangen daher regelmäßige Objektbegehungen, meist im Abstand von 7 bis 14 Tagen, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Wird das versäumt, kann die Leistung im Schadensfall verweigert werden.
Was viele Eigentümer nicht wissen – aber dringend beachten sollten
Versicherungsbedingungen bei Leerstand: Meldepflichten und Rechte
Wird ein Gebäude nicht mehr bewohnt, muss das dem Versicherer unverzüglich gemeldet werden – sonst drohen im Schadensfall Leistungskürzungen oder sogar die komplette Verweigerung der Erstattung. Was als Leerstand gilt, wie lange er dauern darf, und welche Fristen zu beachten sind, ist in den Versicherungsbedingungen klar geregelt – und wird oft unterschätzt.
Zudem haben Versicherungsnehmer bestimmte Rechte, wenn sich durch den Leerstand die Vertragsbedingungen ändern – z. B. das Recht auf Sonderkündigung bei Beitragserhöhung. Genau diese Punkte klären wir in den folgenden Tabs.
Ein Gebäude gilt in der Regel als leerstehend, wenn es länger als 60 Tage unbewohnt und unbeaufsichtigt ist.
In den meisten Versicherungsbedingungen ist festgelegt, dass Leerstand unverzüglich gemeldet werden muss – sonst kann es zu Leistungskürzungen oder Kündigungen kommen.
Vorübergehender Leerstand bis zu 3 Monaten (z. B. nach Auszug) wird teils anders behandelt – aber nur bei vorheriger Rücksprache mit dem Versicherer.
Auch Umbau- oder Sanierungsphasen müssen gemeldet werden, wenn sie mit Leerstand verbunden sind.
Die Versicherung kann Nachweise über Kontrollgänge, Sicherungen oder technische Maßnahmen verlangen.
Tipp: Dokumentieren Sie Leerstand, Kontrollintervalle und technische Maßnahmen schriftlich – das schützt im Streitfall.
Leerstand stellt eine Gefahrenerhöhung dar – deshalb dürfen Versicherer die Beiträge anpassen (meist 10–50 % Zuschlag).
Erfolgt eine Beitragserhöhung aufgrund des Leerstands, steht dem Versicherungsnehmer ein Sonderkündigungsrecht zu (§ 40 VVG).
Dieses muss innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Beitragserhöhung ausgeübt werden.
Bei unklarer Risikolage können Versicherer auch bestimmte Schäden ausschließen oder den Vertrag vollständig beenden.
Wer rechtzeitig meldet, kann stattdessen gezielt einen Tarif für leerstehende Gebäude oder eine Spezialpolice wählen.
Tipp: Nutzen Sie unser Vergleichsrechner, um den passenden Versicherungsschutz bei Leerstand zu finden – ohne überhöhte Prämien.
Schäden vermeiden – bevor sie entstehen
Wie Sie Ihr leerstehendes Gebäude aktiv schützen
Ein leerstehendes Haus muss nicht schutzlos sein. Mit den richtigen Maßnahmen können Sie viele Risiken gezielt minimieren – und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Wohngebäudeversicherung auch im Ernstfall leistet.
Regelmäßige Objektkontrollen sind das A und O: Viele Versicherer verlangen, dass das Gebäude mindestens alle 7 bis 14 Tage kontrolliert wird. Achten Sie dabei auf Heizsystem, Dach, Fenster, Wasserleitungen und Anzeichen von Einbruch oder Vandalismus. Dokumentieren Sie Ihre Begehungen bestenfalls schriftlich.
Zudem sollten alle wasserführenden Leitungen entleert und abgesperrt sein – das verhindert Frostschäden im Winter. Heizungen sollten auf Frostschutzbetrieb laufen, Dämmung und Lüftung auf Funktion geprüft werden.
Auch technische Sicherungen helfen: Bewegungsmelder, Smart-Home-Überwachung, Kameraattrappen oder Alarmanlagen wirken abschreckend. Fenster und Türen lassen sich mit Zusatzschlössern oder Sicherheitsfolie nachrüsten.
Viele Versicherer verlangen sogar, dass Außenbeleuchtung mit Zeitschaltuhren installiert ist. Das simuliert Anwesenheit und reduziert das Einbruchsrisiko.
➡️ Tipp: Wer Leerstand professionell absichert, profitiert nicht nur von besserem Versicherungsschutz – sondern verhindert auch hohe Folgekosten durch vermeidbare Schäden.
Das sollten Sie zum Thema Leerstand unbedingt mitbedenken
Weitere wichtige Versicherungen und Informationen für Eigentümer
Ein leerstehendes Gebäude betrifft nicht nur die Wohngebäudeversicherung. Auch ergänzende Policen und wichtige Hintergrundthemen spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Risiken umfassend abzusichern – und den Versicherungsschutz im Ernstfall nicht zu verlieren.

Wohngebäudeversicherung
Ein undichtes Dach bleibt oft lange unbemerkt – bis Feuchtigkeit Wände, Dämmung oder Elektrik angreift. Ob altersbedingter Verschleiß oder sturmbedingte Beschädigung: Je nach Ursache greift die Wohngebäudeversicherung – oder auch nicht.

Elementarversicherung
Schimmel entsteht häufig durch Feuchtigkeit – etwa nach einem Sturmschaden, Rohrbruch oder mangelhafter Dämmung. Die Versicherung zahlt nur bei versichertem Auslöser. Vorbeugung und schnelles Handeln sind entscheidend.
Zusammenfassung
Ein leerstehendes Gebäude ist nicht automatisch schlecht versichert – aber es erfordert aktive Maßnahmen und eine offene Kommunikation mit der Versicherung. Meldepflichten, Sicherungspflichten und mögliche Beitragserhöhungen machen die richtige Tarifwahl entscheidend.
Nur wer Leerstand ordnungsgemäß meldet, regelmäßig kontrolliert und das Gebäude technisch absichert, kann auf umfassenden Schutz vertrauen. Die Wohngebäudeversicherung greift nur dann, wenn alle Bedingungen eingehalten wurden. Wer zusätzlich auf Elementarschutz, Hausratversicherung und spezielle Zusatzbausteine achtet, sichert sich gegen nahezu alle Risiken zuverlässig ab.
häufige Fragen
Wann gilt ein Gebäude als leerstehend?
Ein Gebäude gilt als leerstehend, wenn es nicht genutzt, nicht bewohnt und nicht regelmäßig kontrolliert wird – meist nach mehr als 60 Tagen ohne Nutzung. Eine kurze Mietlücke kann also schnell als Leerstand gelten.
Muss ich den Leerstand immer melden?
Ja – der Leerstand ist anzeigepflichtig. Wird er nicht gemeldet, kann der Versicherer im Schadensfall die Leistung verweigern oder den Vertrag kündigen.
Steigt die Prämie durch Leerstand automatisch?
Häufig ja: Viele Versicherer erheben einen Leerstandszuschlag von 10 % bis 50 % auf die reguläre Prämie. Dafür ist der Schutz aber auch auf die Risikolage angepasst.
Welche Schäden werden bei Leerstand besonders kritisch?
Typische Risiken sind Frostschäden, Einbruch, Vandalismus und technische Defekte. Ohne regelmäßige Kontrolle kann die Versicherung im Ernstfall die Regulierung einschränken.

