Nebengebäude versichern – so schützen Sie Gartenhaus, Schuppen & Co. richtig
Ob Geräteschuppen, Gewächshaus oder Bootshaus – mit dem richtigen Versicherungsschutz bleibt Ihr Eigentum in sicheren Händen

Gartenhäuser, Schuppen oder auch kleine Werkstätten sind oft das Herzstück des Grundstücks – ob als Stauraum, Rückzugsort oder Hobbybereich. Doch was viele Hausbesitzer unterschätzen: Nebengebäude sind regelmäßig Ziel von Stürmen, Einbrüchen oder Wasserschäden. Ohne passenden Versicherungsschutz können Schäden schnell teuer werden. Besonders wenn das Gebäude nicht gemeldet oder nur teilweise versichert ist, drohen im Ernstfall erhebliche finanzielle Verluste. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Ihre Nebengebäude optimal absichern, wann sie automatisch mitversichert sind – und wann eine separate Police nötig ist.
Das Wichtigste auf einem Blick
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
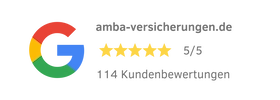
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Mehr als nur Beiwerk – warum die Absicherung von Nebengebäuden oft unterschätzt wird
Was zählt als Nebengebäude – und warum ist der richtige Versicherungsschutz so entscheidend?
Ob Geräteschuppen, Gewächshaus oder das liebevoll ausgebaute Gartenhaus mit Stromanschluss – Nebengebäude sind in vielen Haushalten fester Bestandteil des Alltags. Sie bieten zusätzlichen Stauraum, Platz für Hobbys oder lagern oft teure Gegenstände. Umso überraschender ist, dass viele Hausbesitzer nicht wissen, ob diese Gebäude überhaupt versichert sind – und wenn ja, in welchem Umfang.
Ein falscher Eindruck entsteht oft dadurch, dass Nebengebäude auf demselben Grundstück wie das Wohnhaus stehen. Doch das allein garantiert noch keinen vollständigen Schutz durch die Wohngebäudeversicherung. Je nach Größe, Bauart, Nutzung und Zeitpunkt der Errichtung kann eine Nachmeldung oder sogar eine separate Police notwendig sein.
Damit Sie die Unterschiede besser einordnen können, zeigen wir Ihnen in der folgenden Übersicht, welche Gebäudetypen als Nebengebäude gelten – und worauf Sie beim Versicherungsschutz besonders achten sollten.
Dienen meist der privaten Lagerung (z. B. Werkzeug, Fahrräder, Gartenmöbel)
Häufig automatisch mitversichert, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:
Gebäude steht auf demselben Grundstück wie das Wohnhaus
Fläche nicht größer als 25–30 m² (je nach Versicherer)
Keine gewerbliche Nutzung
Achtung: Stromanschluss, Heizung oder Wasserleitungen sollten gemeldet werden!
Nutzung zur Aufzucht von Pflanzen – oft aus Kunststoff oder Glas
Versicherungsschutz abhängig von:
Materialanteil (Glas/Kunststoff) – bei mehr als 50 % kann Ausschluss gelten
Verankerung – mobile oder Leichtbaukonstruktionen sind meist nicht automatisch versichert
Empfehlung: Zusatzbaustein oder Einzelmeldung prüfen
Höherer Wiederbeschaffungswert und spezielle Nutzung
Fast immer separat zu versichern
Risiken durch Brand, Einbruch, Vandalismus oder Wasser (z. B. bei direkter Nähe zu Gewässern)
Gewisse Versicherer bieten hier Sonderkonzepte
Problematisch bei unklarer Bausubstanz oder fehlender Baugenehmigung
Versicherungsschutz nur nach Risikoprüfung möglich
Häufig ist eine Wertermittlung oder Fotodokumentation erforderlich
Melden Sie jedes neue oder veränderte Nebengebäude unverzüglich Ihrem Versicherer. Schon kleine Details wie Fensterflächen, Elektroinstallationen oder ein nachträglich eingebauter Kaminofen können den Versicherungsschutz beeinflussen.
Mitversichert oder nicht? So erkennen Sie, ob Ihr Nebengebäude bereits Teil der Police ist
Wann sind Nebengebäude automatisch in der Wohngebäudeversicherung enthalten?
Viele Eigentümer gehen davon aus, dass alle Gebäude auf dem Grundstück automatisch mitversichert sind – insbesondere kleinere Nebengebäude wie Gartenhäuser oder Schuppen. Doch das ist ein gefährlicher Irrtum. Ob und in welchem Umfang ein Nebengebäude in die bestehende Wohngebäudeversicherung integriert ist, hängt von mehreren Faktoren ab – und variiert je nach Versicherer deutlich.
Einige Policen schließen bestimmte Nebengebäude standardmäßig ein, vor allem wenn sie:
sich auf demselben Grundstück wie das versicherte Wohnhaus befinden,
baulich abgeschlossen, fest verankert und nicht mobil sind,
ausschließlich privat genutzt werden,
und bestimmte Größen- oder Materialgrenzen nicht überschreiten (z. B. max. 25–30 m² Grundfläche, max. 50 % Glas/Kunststoffanteil).
In diesen Fällen sind sie häufig ohne Aufpreis mitversichert. Doch selbst wenn der Grundschutz greift, bedeutet das noch nicht automatisch, dass auch alle Risiken wie Elementarschäden, Einbruch oder Vandalismus abgedeckt sind. Häufig gelten hier Ausschlüsse – oder es sind Sublimits gesetzt (z. B. Entschädigungsgrenzen bei Sturm).
Ein häufiger Fehler: Nachträglich errichtete Gebäude – etwa ein neu gebauter Carport oder ein zusätzliches Gartenhaus – werden nicht automatisch in den Versicherungsschutz aufgenommen. In solchen Fällen ist eine Meldung an den Versicherer Pflicht, idealerweise vor Baubeginn oder direkt nach Fertigstellung. Nur dann kann die Police angepasst und eine Überprüfung der Risikoeinstufung vorgenommen werden.
Ein weiterer Aspekt: Versicherer definieren den Begriff „Nebengebäude“ nicht einheitlich. Während Anbieter A ein 30 m²-Gartenhaus automatisch mitversichert, fordert Anbieter B eine Einzelbewertung ab 20 m². Auch Nutzung, Bauweise oder Ausstattung (z. B. Stromanschluss, Dämmung, Feuerstätte) spielen dabei eine Rolle.
Wenn das Gartenhaus zur Werkstatt wird – warum manche Nebengebäude eine eigene Police brauchen
Wann ist eine separate Versicherung für Ihr Nebengebäude notwendig?
Nicht jedes Nebengebäude kann über die klassische Wohngebäudeversicherung abgedeckt werden. Gerade bei größeren Flächen, höherem Wert oder abweichender Nutzung reicht der Basisschutz nicht mehr aus – eine separate Gebäude- oder Inhaltsversicherung wird dann unverzichtbar.
Je größer das Nebengebäude, desto wahrscheinlicher ist, dass es nicht mehr automatisch mitversichert ist. Das gilt besonders bei Gebäuden, die:
eine Grundfläche von über 30 m² aufweisen,
massiv gebaut sind oder besondere bauliche Merkmale aufweisen (z. B. Dachgauben, Kamin),
gewerblich oder teilgewerblich genutzt werden (z. B. als Lager, Werkstatt, Vermietung),
sich nicht auf dem gleichen Grundstück wie das versicherte Wohnhaus befinden,
oder über eine wertsteigernde Ausstattung verfügen (z. B. isoliert, beheizt, mit Photovoltaik-Anlage oder Kfz-Stellplatz mit Ladeeinrichtung).
In diesen Fällen lehnt der Versicherer entweder die Mitversicherung ab – oder erfordert eine separate Risikoerfassung, verbunden mit einem individuellen Versicherungsangebot. Das betrifft z. B. Bootshäuser am See, frei stehende Garagenkomplexe oder alte Scheunen, die zu Hobbyräumen umgebaut wurden.
Auch Carports und große Garagen werden in vielen Verträgen nur bis zu bestimmten Wertgrenzen mitversichert – oder sie zählen gar nicht zu den Nebengebäuden, sondern zu den sogenannten “baulichen Nebenanlagen”. Hier ist eine exakte Definition durch den Versicherer entscheidend.
Ein Sonderfall sind Nebengebäude mit Misch- oder Fremdnutzung. Wird ein Teil des Gebäudes beispielsweise als Lager für gewerbliches Material oder als Hobbywerkstatt mit Maschinen genutzt, ist das ein versicherungstechnisches Risiko, das unbedingt gemeldet und separat abgesichert werden muss – idealerweise durch eine gewerbliche Gebäudeversicherung oder eine Betriebshaftpflicht in Kombination.
📌 Tipp:
Wer größere oder wertvolle Nebengebäude besitzt, sollte vor dem Versicherungsabschluss unbedingt ein individuelles Beratungsgespräch führen – inklusive Wertermittlung und Nutzungsklärung. Nur so kann die Police exakt auf das Gebäude zugeschnitten werden – ohne Leistungsausschlüsse im Schadensfall.
Diese Bausteine machen Ihre Wohngebäudeversicherung noch sicherer
Zusatzbausteine, die Ihr Wohnhaus optimal ergänzen
Beim Abschluss oder Wechsel der Wohngebäudeversicherung sollten Sie den Blick über den Standardtarif hinaus richten. Viele Risiken sind nicht automatisch abgedeckt, lassen sich aber gezielt über Zusatzbausteine versichern. Die folgenden Erweiterungen bieten Ihnen mehr Sicherheit – besonders bei Extremwetterlagen, technischen Schäden oder rechtlichen Auseinandersetzungen.
Grobe Fahrlässigkeit

Ein nicht ausgeschalteter Herd oder eine brennende Kerze können zum Totalschaden führen. Der Baustein „Grobe Fahrlässigkeit“ sorgt dafür, dass Ihre Versicherung auch dann zahlt, wenn Sie im Alltag einmal einen Fehler machen.
Elementarversicherung

Immer häufiger führen Starkregen, Rückstau oder Überschwemmung zu massiven Schäden am Haus. Die klassische Wohngebäudeversicherung deckt diese Naturgefahren nicht ab – dafür braucht es den Zusatzbaustein „Elementar“. Besonders in Risikogebieten unverzichtbar.
Unbenannte Gefahren

Nicht alle Schäden lassen sich vorhersehen oder sind versichert. Der Baustein „Unbenannte Gefahren“ sichert Sie gegen plötzlich und unvorhersehbar eintretende Schäden ab – ideal für maximale Sicherheit.
Nicht zu hoch, nicht zu niedrig – warum die richtige Bewertung entscheidend ist
Wertermittlung und Risikoprüfung bei Nebengebäuden – so vermeiden Sie Deckungslücken
Ein wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Versicherungsschutzes ist die realistische Einschätzung des Werts und der Risiken eines Nebengebäudes. Denn nur wenn Sie wissen, wie viel das Gebäude im Schadenfall kostet – und welche Gefahren überhaupt bestehen – kann die Versicherung korrekt kalkuliert und ausgezahlt werden.
Viele Nebengebäude – besonders ältere oder selbst errichtete – sind schwer zu bewerten. Schäden an maroden Dächern, veralteten Stromleitungen oder feuchtem Mauerwerk führen schnell zu höheren Prämien oder sogar zur Ablehnung durch den Versicherer. Darum ist eine individuelle Risikoprüfung notwendig: Welche Baumaterialien wurden verwendet? Ist das Gebäude beheizt? Gibt es Fenster oder Stromanschlüsse?
Auch der Zustand spielt eine zentrale Rolle. Versicherer bewerten die Substanz, die Nutzung und die Umgebungslage (z. B. Nähe zu Gewässern, Hanglage, Bäume) und gleichen diese mit potenziellen Gefahren wie:
Sturm‑, Hagel- oder Schneelastschäden
Einbruch, Diebstahl oder Vandalismus
Brandrisiken durch Elektrogeräte, Feuerstellen oder brennbare Lagergüter
Wasserschäden durch alte Leitungen oder nicht frostgeschützte Installationen
Parallel dazu ist eine exakte Wertermittlung entscheidend – idealerweise auf Basis des Neuwerts oder des Wiederaufbauwerts. Zu niedrige Angaben führen zur Unterversicherung (Sie erhalten im Schadenfall nur einen Teil der Kosten ersetzt), zu hohe Werte zu unnötig hohen Beiträgen. Besonders wenn Sie den Schutz erweitern oder einen Altbau nachträglich versichern möchten, ist eine sachkundige Bewertung durch einen Gutachter zu empfehlen.
Je genauer die Angaben bei Antragstellung sind, desto reibungsloser läuft die Schadenregulierung. Achten Sie deshalb auf vollständige Angaben zu Fläche, Baujahr, Nutzung, Ausstattung und Zustand – und aktualisieren Sie diese bei Veränderungen sofort.
Nicht jeder Tarif passt zu jedem Gebäude – worauf Sie wirklich achten sollten
So wählen Sie die passende Versicherung für Ihre Nebengebäude aus
Die Auswahl der richtigen Versicherung für ein Nebengebäude ist kein Standardvorgang – denn die Anforderungen sind so individuell wie die Gebäude selbst. Ob Sie ein kleines Gartenhaus schützen wollen oder eine größere, elektrisch ausgestattete Werkstatt: Der Tarif muss zur Nutzung, zur Bausubstanz und zur Risikostruktur passen.
Zentral ist zunächst die Nutzungsart: Wird das Nebengebäude rein privat genutzt (z. B. als Lager, Hobbyraum oder Unterstand), reicht in vielen Fällen eine erweiterte Wohngebäudeversicherung. Sobald jedoch eine gewerbliche oder teilgewerbliche Nutzung ins Spiel kommt – etwa bei einer kleinen Werkstatt, einem Atelier oder der Lagerung von Betriebsmaterialien – ist eine eigenständige Police erforderlich.
Auch der bauliche Zustand des Gebäudes spielt eine Rolle. Marode Dächer, fehlende Fundamentierung oder ältere Stromleitungen erhöhen das Risiko und können zu Prämienaufschlägen führen – oder zur Ablehnung des Versicherungsschutzes. Daher lohnt es sich, vor Abschluss einer Police eventuelle Mängel zu beheben oder das Gebäude fachmännisch instand setzen zu lassen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Region, in der sich das Gebäude befindet: In hochwassergefährdeten oder sturmreichen Gegenden verlangen viele Versicherer eine Elementardeckung – oder sie schließen diese Risiken in Basistarifen sogar aus. Auch hier hilft der gezielte Vergleich, um nicht auf unversicherten Risiken sitzen zu bleiben.
Was Sie konkret prüfen sollten:
Welche Schadensarten (z. B. Feuer, Leitungswasser, Einbruch, Naturgefahren) sind abgedeckt?
Gibt es Obergrenzen für Entschädigungen oder Selbstbeteiligungen?
Ist der Neuwert oder Zeitwert versichert?
Wie wird grobe Fahrlässigkeit bewertet?
Gibt es Besonderheiten bei Glasflächen, Stromanschluss, Heizungen oder Solartechnik?
Nutzen Sie den Wechsel oder Neuabschluss der Gebäudeversicherung, um auch Ihre Nebengebäude professionell mit absichern zu lassen
Was Sie schon immer wissen wollten
Fragen & Antworten zur Versicherung von Nebengebäuden
Zählt eine freistehende Garage als Nebengebäude?
Ja – freistehende Garagen gelten in der Regel als Nebengebäude, sofern sie sich auf demselben Grundstück wie das versicherte Wohnhaus befinden. Sie können je nach Vertrag automatisch mitversichert sein oder müssen separat angegeben werden.
Ab welcher Größe braucht ein Nebengebäude eine eigene Versicherung?
Es gibt keine einheitliche Grenze, aber viele Versicherer setzen eine Fläche von ca. 25 bis 30 m² als Obergrenze für die automatische Mitversicherung. Alles darüber hinaus sollte einzeln geprüft und ggf. separat versichert werden.
Was passiert, wenn ich ein neues Nebengebäude nicht melde?
Wird ein Nebengebäude nicht gemeldet, kann das im Schadensfall zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Der Versicherer kann die Leistung verweigern oder deutlich kürzen – besonders wenn sich das Risiko dadurch verändert hat.
Sind Stromanschluss oder Heizung im Gartenhaus ein Problem für die Versicherung?
Nicht automatisch, aber sie beeinflussen die Risikobewertung. Elektrische Installationen oder Heizquellen erhöhen die Brandgefahr – daher sollten solche Ausstattungen unbedingt im Versicherungsantrag angegeben werden.
Deckt die Wohngebäudeversicherung auch Sturmschäden am Schuppen?
Ja – sofern das Nebengebäude in der Police korrekt erfasst ist, sind typische Naturgefahren wie Sturm oder Hagel mitversichert. Wichtig ist, dass Größe, Bauweise und Standort den Versicherungsbedingungen entsprechen.
Was ist nicht versichert – trotz Nebengebäude-Police?
Nicht versichert sind z. B. bewegliche Gegenstände im Gebäude (diese zählen zur Hausratversicherung), baurechtlich nicht genehmigte Bauten oder Schäden durch ungemeldete Nutzungsänderungen. Auch Vorsatz ist generell ausgeschlossen.
Gilt der Schutz auch für Nebengebäude auf einem anderen Grundstück?
In der Regel nein. Die meisten Wohngebäudeversicherungen decken nur Gebäude auf dem Grundstück ab, das im Versicherungsvertrag genannt ist. Für externe Grundstücke muss eine gesonderte Police abgeschlossen werden.
Was ist mit alten, sanierungsbedürftigen Schuppen?
Diese können unter Umständen versichert werden – jedoch meist nur nach einer Risikoprüfung und oft mit Auflagen. Der bauliche Zustand beeinflusst die Annahme, den Beitrag und den Leistungsumfang.
Weitere wichtige Absicherungen & Themen für Hausbesitzer
Als Eigentümer sollten Sie nicht nur Ihre Gebäude optimal absichern, sondern auch angrenzende Risiken im Blick behalten – von Einbruch über Streitigkeiten mit Behörden bis hin zur Absicherung moderner Technik. Diese Themen helfen Ihnen, Ihr Eigentum ganzheitlich zu schützen und den Überblick zu behalten.

Rechtsschutzversicherung
Ob Ärger mit Handwerkern, Nachbarn oder Behörden – im Ernstfall hilft eine Rechtsschutzversicherung dabei, Ihr gutes Recht durchzusetzen. Sie schützt vor hohen Anwalts- und Gerichtskosten und ist besonders für Immobilieneigentümer mit Bau- oder Sanierungsprojekten empfehlenswert.

Hausratversicherung
Während die Wohngebäudeversicherung die Bausubstanz schützt, sichert die Hausratversicherung Ihr bewegliches Eigentum ab – von Möbeln bis zur Unterhaltungselektronik. Besonders bei Einbruch, Brand oder Leitungswasser zahlt sie für Wiederbeschaffung und Reparatur.
Weitere Themen
- Photovoltaik-Versicherung: Schutz für Ihre Solaranlage
- Wallbox richtig absichern – das müssen Sie wissen
- Gebäudeversicherung im Vergleich – finden Sie den besten Tarif
- Typische Schadensfälle in der Wohngebäudeversicherung
- Was bedeutet eigentlich „Wert 1914“?
- So funktioniert der Anpassungsfaktor bei Beiträgen
Zusammenfassung
Nebengebäude sind ein oft unterschätzter Bestandteil des Versicherungsschutzes – dabei können sie im Ernstfall erhebliche Werte darstellen. Ob Gerätehaus, Garage, Bootshaus oder Werkraum: Nicht jedes Gebäude ist automatisch durch die Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Größe, Nutzung, Bauweise und Ausstattung entscheiden darüber, ob ein Zusatzschutz nötig ist. Auch bei neuen Bauten ist eine zeitnahe Meldung essenziell. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt eine professionelle Wertermittlung durchführen und prüft gemeinsam mit einem Versicherungsmakler, welche Policen und Bausteine zum eigenen Objekt passen. So sichern Sie Ihr Eigentum ganzheitlich und langfristig zuverlässig ab.
häufige Fragen
Ist eine Scheune ein Nebengebäude?
Ja – eine Scheune gilt als Nebengebäude, sofern sie sich auf dem gleichen Grundstück befindet wie das Wohnhaus. Je nach Größe, Zustand und Nutzung (z. B. landwirtschaftlich oder gewerblich) ist jedoch meist eine separate Versicherung notwendig.
Sind Nebengebäude in der Wohngebäudeversicherung mitversichert?
Teilweise. Kleinere, privat genutzte Nebengebäude auf demselben Grundstück sind bei vielen Versicherern mitversichert – meist bis zu 25–30 m². Größere oder anders genutzte Gebäude müssen separat angegeben oder versichert werden.
Was zählt alles als Nebengebäude?
Als Nebengebäude gelten unter anderem Gartenhäuser, Schuppen, freistehende Garagen, Werkstätten, Gewächshäuser, Bootshäuser oder kleine Lagerhallen – sofern sie baulich vom Hauptgebäude getrennt sind und auf dem gleichen Grundstück stehen.
Ist ein Geräteschuppen versichert?
Ein Geräteschuppen kann in der Wohngebäudeversicherung enthalten sein – vorausgesetzt, er erfüllt die vertraglichen Kriterien: z. B. maximale Größe, private Nutzung und bestimmte Bauweise. Es lohnt sich, dies im Vertrag oder durch eine Beratung zu prüfen.

