Wohnfläche Wohngebäudeversicherung: Wohnflächenberechnung – einfach erklärt
Welche Fläche zählt wirklich? Wir zeigen, wie Sie Wohnfläche korrekt berechnen – und warum das für den Versicherungsschutz entscheidend ist

Die exakte Ermittlung der Wohnflächen bildet die Berechnungsgrundlage für die Versicherungsprämien. Sie ist damit ein zentrales Kriterium – nicht nur für die Wohngebäudeversicherung, sondern auch für steuerliche Bewertungen und rechtliche Fragen im Immobilienbereich.
Für Eigentümer, Bauherren und Mieter ist die korrekte Wohnflächenangabe von großer Bedeutung. Sie entscheidet im Ernstfall darüber, ob die Versicherung leistet – oder ob eine Unterversicherung vorliegt. Besonders bei Umbauten oder Sanierungen besteht ein erhöhtes Risiko, die Fläche unzutreffend zu melden. Die Folge: finanzielle Einbußen im Schadensfall.
Häufig herrscht Unsicherheit darüber, welche Berechnungsmethode angewendet werden soll – etwa die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder die DIN 277. Beide unterscheiden sich deutlich in ihrer Systematik und führen zu abweichenden Ergebnissen, was sich direkt auf Versicherungsprämien und Leistungen auswirken kann.
In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Wohnflächen für Versicherungszwecke richtig ermittelt werden, welche Normen zur Anwendung kommen und warum eine exakte Angabe im Vertrag unerlässlich ist. Denn nur wer beim Abschluss einer Wohngebäudeversicherung die korrekte Wohnfläche angibt, sorgt dafür, dass das Zuhause nicht nur ästhetisch überzeugt – sondern auch vollständig und wirksam abgesichert ist.
Das Wichtigste im Überblick
- Die Wohnfläche bildet eine zentrale Grundlage zur Beitragsberechnung in der Gebäudeversicherung.
- Die Definition, welche Flächen angerechnet werden, kann je Versicherer und Tarif variieren (z. B. Anrechnung von Dachschrägen, Wintergärten, Balkonen).
- Eine fehlerhafte oder unvollständige Wohnflächenangabe kann im Schadenfall zu Leistungskürzungen wegen Unterversicherung führen.
- Versicherungsbedingungen oder Tarifdarstellungen enthalten meist eine verbindliche Vorgabe, nach welcher Methode die Wohnfläche zu berechnen ist.
- Gängige Berechnungsgrundlagen sind die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und in manchen Fällen die DIN 277 oder eine individuelle Definition des Versicherers.
- Bei Umbauten oder Nutzungsänderungen (z. B. Ausbau von Dachgeschoss, Einbau Hobbyraum) sollten Sie rechtzeitig eine Anpassung der Wohnfläche beim Versicherer melden.
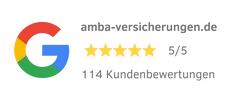
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Warum falsche Quadratmeterangaben teuer werden können – und wie Sie richtig handeln
Die Wohnfläche – Grundlage für Ihre Versicherungsbeiträge und Ihren Schutz im Ernstfall
Die Angabe der richtigen Wohnfläche ist eine zentrale Voraussetzung für eine korrekte Berechnung Ihrer Gebäudeversicherung. Sie entscheidet nicht nur über die Höhe Ihrer Beiträge, sondern vor allem über die Leistungen im Schadensfall. Wird die Wohnfläche zu klein angegeben, liegt eine sogenannte Unterversicherung vor – mit schwerwiegenden Folgen: Im Ernstfall ersetzt der Versicherer dann nicht den vollständigen Schaden, sondern kürzt anteilig entsprechend der falschen Angabe.
Für Eigentümer ist es daher essenziell, bei Vertragsabschluss oder späteren Änderungen (z. B. durch Umbauten) eine präzise Wohnflächenberechnung vorzulegen. Je nach Versicherer werden unterschiedliche Methoden akzeptiert – insbesondere die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder die DIN-Norm 277. Beide führen oft zu unterschiedlichen Ergebnissen – je nachdem, wie z. B. Balkone, Dachschrägen oder Nebenräume gewertet werden.
Darüber hinaus kann eine falsche Angabe nicht nur die Gebäudeversicherung, sondern auch weitere Policen wie die Hausratversicherung beeinflussen. Wer z. B. 30 statt 45 m² angibt, riskiert auch dort eine zu geringe Leistung im Schadensfall. Ebenso sind Nebenkosten, Mieterhöhungen und Mietminderungen in der Wohnwirtschaft eng an die korrekte Fläche gekoppelt. Gerade bei einer Mieterhöhung spielt die exakte Wohnfläche eine entscheidende Rolle, da sie die Grundlage für die Berechnung der neuen Miete bildet.
Damit Sie besser nachvollziehen können, in welchen Fällen die Wohnfläche konkret Auswirkungen hat, finden Sie hier eine Übersicht typischer Szenarien:
Eine zu niedrig angegebene Quadratmeterzahl spart zwar auf den ersten Blick Prämien – führt aber direkt in die Unterversicherung. Im Klartext: Wird Ihre tatsächliche Wohnfläche z. B. mit 120 m² berechnet, Sie haben jedoch nur 100 m² angegeben, ersetzt die Versicherung im Schadensfall nur 5/6 der tatsächlichen Kosten. Diese sogenannte Proportionalregelung gilt bei fast allen Anbietern – mit wenigen Ausnahmen.
Tipp: Einige Versicherer bieten Unterversicherungsverzicht ab bestimmten Quadratmeter- oder Wertgrenzen.
Auch eine zu hoch angegebene Fläche kann problematisch sein – allerdings auf der Kostenseite. Sie zahlen in diesem Fall mehr Beitrag als nötig, erhalten im Schadenfall aber keine Mehrleistung. Der Versicherer prüft nämlich anhand des tatsächlichen Werts bzw. der realen Wohnfläche. Insofern lohnt es sich, die Angaben regelmäßig zu überprüfen – vor allem bei geerbten Immobilien oder Altbauten mit unklarer Dokumentation. Die exakte Größe der Wohnfläche ist für die Bewertung und die Versicherungswerte von zentraler Bedeutung.
Ob Dachausbau, Wintergarten oder zusätzliche Einliegerwohnung – Veränderungen an der Immobilie wirken sich direkt auf die Wohnfläche aus. Diese müssen unverzüglich dem Versicherer gemeldet werden. Ansonsten droht im Schadensfall erneut eine Unterversicherung oder sogar eine Leistungskürzung wegen Obliegenheitsverletzung.
Empfehlung: Prüfen Sie nach jeder baulichen Veränderung die korrekte Erfassung der Fläche in der Police.
Auch bei der Hausratversicherung ist die Wohnfläche ein wichtiger Parameter. Je nach Tarif hängt die Versicherungssumme direkt von der angegebenen Quadratmeterzahl ab – oft wird pauschal mit 650 € je m² gerechnet. Unterschiedliche Tarife der Versicherer berücksichtigen dabei verschiedene Methoden der Wohnflächenermittlung. Die Wohnungsgröße ist für die Beitragsberechnung und die Höhe der Versicherungssumme maßgeblich, da eine zu kleine oder zu große Angabe zu finanziellen Nachteilen führen kann. Ist die Fläche falsch, stimmt die Deckung nicht. Ebenso spielen Quadratmeterangaben eine Rolle bei:
Mietverträgen (z. B. bei Mieterhöhungen, wobei die korrekte Wohnfläche für Vermietern essenziell ist, um rechtliche Grundlagen einzuhalten und Konflikte mit Mietern zu vermeiden)
Mietverträgen (die Wohnfläche ist maßgeblich für die Mietpreisgestaltung und beeinflusst die Höhe der Mietkosten)
Nebenkostenabrechnungen
Betriebskostenabrechnung (die Wohnfläche ist Grundlage für die rechtssichere und transparente Abrechnung der Betriebskosten im Mietverhältnis)
Steuerlicher Bewertung von Immobilien
Förderanträgen oder energetischen Sanierungen
Zwei Methoden, zwei Ergebnisse – und warum die Wahl entscheidend für Ihre Versicherung ist
Wie wird die Wohnfläche korrekt berechnet?
Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend, insbesondere im Kontext der Gebäudeversicherung. In Deutschland werden hauptsächlich zwei Methoden angewendet: die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und die DIN-Norm 277. Die Grundlagen dieser Methoden sind in gesetzlichen Vorschriften und technischen Normen verankert, die die Basis für die Bewertung und Messung der Wohnflächen bilden. Beide führen zu unterschiedlichen Ergebnissen, was direkte Auswirkungen auf Versicherungsprämien und Leistungen im Schadensfall haben kann.
Die Wohnflächenverordnung (WoFlV), seit dem 1. Januar 2004 in Kraft, ist die gesetzliche Grundlage für die Berechnung der Wohnfläche in Deutschland, insbesondere im Mietrecht und bei öffentlich gefördertem Wohnraum. Sie berücksichtigt ausschließlich die tatsächlich zum Wohnen genutzten Flächen. Die Ermittlung der Wohnfläche erfolgt dabei nach den Vorgaben der WoFlV, wobei nur bestimmte Räume und Flächen wie Wohn- und Nutzfläche, aber keine Kellerräume oder Garagen, einbezogen werden. Dabei werden Räume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Badezimmer vollständig angerechnet. Besonderheiten wie Dachschrägen werden differenziert behandelt: Flächen mit einer lichten Höhe unter einem Meter bleiben unberücksichtigt, während Flächen zwischen einem und zwei Metern Höhe zu 50 % angerechnet werden. Balkone, Terrassen und Loggien fließen in der Regel mit 25 %, maximal jedoch mit 50 % in die Wohnflächenberechnung ein.
Im Gegensatz dazu steht die DIN-Norm 277, die vor allem im Neubau und bei der Planung von Immobilien Anwendung findet. Sie berechnet die Brutto-Grundfläche eines Gebäudes und zieht davon die Konstruktionsflächen (z. B. Wände, Pfeiler) ab, um die Netto-Raumfläche zu ermitteln. Diese wird weiter in Nutz‑, Verkehrs- und Technikflächen unterteilt. Die Wohnflächenberechnung nach DIN umfasst dabei sowohl Wohn- als auch Nutzfläche und bezieht zusätzlich Dachboden, Lagerräume und andere Flächen wie Hobbyräume und Arbeitszimmer vollständig mit ein. Ein wesentlicher Unterschied zur WoFlV besteht darin, dass bei der DIN 277 Raumhöhen keine Rolle spielen. Die Grundflächen aller Räume werden unabhängig von ihrer Höhe vollständig berücksichtigt, wobei der Begriff Raum klar definiert ist und auch Flächen wie Dachboden und Lagerräume einschließt. Alle Flächen, unabhängig von ihrer Höhe, werden vollständig angerechnet. Zudem werden auch Flächen wie Kellerräume, Garagen, unbeheizte Wintergärten und Dachböden vollständig berücksichtigt.
Zu den Besonderheiten der WoFlV zählt, dass Arbeitszimmer und Hobbyräume als Beispiele für Räume gelten, die zur Wohnfläche zählen, sofern sie entsprechend genutzt werden.
Die Wahl der Berechnungsmethode hat direkte Auswirkungen auf die ermittelte Wohnfläche und somit auf Versicherungsbeiträge und ‑leistungen. Unterschiedliche Werte bei der Wohnflächenberechnung beeinflussen die Versicherungsprämie für das Wohngebäude erheblich und bestimmen, in welchem Umfang der Gebäudeversicherer im Schadensfall leistet. Eine nach DIN 277 berechnete Wohnfläche fällt in der Regel größer aus als eine nach WoFlV berechnete, was zu höheren Versicherungsprämien führen kann. Allerdings bietet sie auch einen umfassenderen Versicherungsschutz, da mehr Flächen berücksichtigt werden. Es besteht Unsicherheit bei der Wahl der Berechnungsmethode, was insbesondere für Wohnungen und Versicherte zu Problemen bei der Ermittlung der korrekten Wohnfläche und der Absicherung durch den Gebäudeversicherer führen kann. Es ist daher wichtig, die für Ihre Situation passende Methode zu wählen und die Wohnfläche korrekt zu berechnen, um Unter- oder Überversicherungen zu vermeiden.
Vergleich: Wohnflächenverordnung vs. DIN 277
| Kriterium | Wohnflächenverordnung (WoFlV) | DIN 277 |
|---|---|---|
| Einsatzbereich | Mietrecht, öffentlich geförderter Wohnraum, Immobilienanzeigen, Versicherungen | Neubauplanung, Baukostenermittlung, Immobilienbewertung |
| Ermittlung der Fläche | Berücksichtigung nur der tatsächlich zu Wohnzwecken genutzten Räume | Umfasst die gesamte Brutto-Grundfläche – inkl. technischer, Verkehrs- und Nutzflächen |
| Dachschrägen & Raumhöhe | Bis 1 m Höhe: 0 %, 1–2 m Höhe: 50 %, über 2 m: 100 % | Raumhöhe irrelevant – alle Flächen werden voll angerechnet |
| Balkone, Terrassen, Loggien | Werden anteilig angerechnet (meist 25 % bis max. 50 %) | Werden zu 100 % einbezogen, sofern sie baulich als Nutzfläche gelten |
| Nicht beheizte Nebenräume (z. B. Keller) | In der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt | Werden grundsätzlich vollständig als Nutzfläche berücksichtigt |
| Flächenwirkung auf Versicherung | Führt meist zu geringerer Versicherungssumme bzw. niedrigeren Prämien | Führt oft zu höherer Versicherungssumme, aber besserem Deckungsumfang |
| Akzeptanz bei Versicherern | Häufig bevorzugt, vor allem bei bestehenden Wohnverhältnissen | Zunehmend anerkannt, insbesondere bei Neubauten oder komplexen Objekten |
| Vorteil für Versicherungsnehmer | Günstigere Beiträge bei korrekter Anwendung | Exaktere Bewertung der Gesamtnutzung, mehr Sicherheit bei komplexen Objekten |
Nicht jeder Quadratmeter zählt – aber jeder Fehler kann bares Geld kosten
Was zählt zur Wohnfläche – und was nicht?
Viele Hauseigentümer und Versicherungsnehmer gehen davon aus, dass einfach alle Flächen eines Hauses versichert werden. Doch das ist ein weitverbreiteter Irrtum. Die Wohnflächen sind jedoch entscheidend für die Bewertung von Wohnungen und die Berechnung der Versicherungssumme. Bei der Berechnung der Wohnfläche zählt nicht der gesamte Grundriss, sondern ausschließlich die anrechenbaren, nutzbaren Flächen – und das nach ganz bestimmten Regeln.
Hierbei wird zwischen Wohn- und Nutzfläche unterschieden, um Missverständnisse bei der Flächenangabe zu vermeiden. Die Definition des jeweiligen Raums ist dabei maßgeblich, da nur bestimmte Räume zur Wohnfläche zählen. Die Abgrenzung der Grundflächen ist ebenfalls wichtig, da nicht jede Fläche im Grundriss automatisch zur Wohnfläche gehört.
Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) unterscheidet genau, welche Räume in die Wohnfläche einbezogen werden dürfen – und welche nicht. Die genaue Definition der Räume ist für die korrekte Wohnflächenberechnung unerlässlich. Voll anrechenbar sind dabei klassisch genutzte Wohnräume wie:
Wohnzimmer
Schlafzimmer
Kinderzimmer
Küche
Badezimmer und WC
Bäder (Bäder zählen zur Wohnfläche, sofern sie den Anforderungen der WoFlV entsprechen)
Flure, Vorräume, Abstellräume
Arbeitszimmer
Hobbyräume
Darüber hinaus können Wintergärten, Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen anteilig (meist mit 25 %, in Ausnahmefällen bis zu 50 %) zur Wohnfläche gerechnet werden – vorausgesetzt, sie sind baulich nutzbar und zugänglich. Wintergärten und Schwimmbäder werden nach WoFlV unterschiedlich angerechnet: Beheizte Wintergärten und Schwimmbäder zählen vollständig zur Wohnfläche, während ungeheizte nur zur Hälfte berücksichtigt werden. Schwimmbäder in geschlossenen Räumen werden je nach Beheizung entweder voll oder zur Hälfte angerechnet. Die Anrechnung von Terrassen und Balkonen erfolgt gemäß WoFlV in der Regel mit einem Viertel der Fläche, bei hochwertiger Ausstattung bis zur Hälfte.
Nicht zur Wohnfläche zählen:
Kellerräume
Lagerräume
Dachböden ohne Ausbau
Heizungsräume
Waschküchen
Trockenräume
Treppenhäuser
Garagen
technische Betriebsräume
Besonders wichtig: Auch Raumhöhen spielen eine Rolle. Flächen mit weniger als einem Meter Deckenhöhe bleiben unberücksichtigt, während Bereiche zwischen 1,00 m und 2,00 m Höhe nur zur Hälfte angerechnet werden. Alles über 2,00 m wird voll einbezogen.
Weitere Sonderregeln betreffen fest verbaute Einbaumöbel, Wandnischen, Pfeiler oder Vormauerungen. Hier gilt: Wenn diese eine Fläche von mehr als 0,1 m² aufweisen und höher als 1,50 m sind, zählen sie nicht zur Wohnfläche. Ebenso ausgenommen sind Fenster und Wandnischen, die nicht bis zum Boden reichen oder weniger als 13 cm tief sind.
Diese Bausteine sollten Sie im Blick behalten
Ergänzender Schutz für Ihre Immobilie – jetzt sinnvoll kombinieren
Auch wenn die Wohnfläche korrekt berechnet ist: Eine optimale Absicherung endet nicht bei der Standard-Gebäudeversicherung. Ergänzende Bausteine wie die Elementar- oder Hausratversicherung schützen Sie vor finanziellen Risiken, die oft unterschätzt werden – insbesondere bei Extremwetter, Einbruch oder versteckten Gefahren. Diese Policen lassen sich individuell kombinieren und sorgen für echten Rundumschutz.

Starkregen, Überschwemmung oder Erdrutsch – Naturgefahren nehmen zu und verursachen schnell immense Schäden. Die Elementarversicherung ergänzt Ihre Police gezielt dort, wo der Standardschutz endet – heute in vielen Regionen bereits unverzichtbar.

Ihre Gebäudeversicherung schützt Wände, Dach und Fundament – die Hausratversicherung dagegen alles, was darin lebt: Möbel, Technik, Kleidung. Besonders bei Einbruch, Feuer oder Leitungswasserschäden ist diese Police ein Muss für jede Wohnung.

Wenn der Herd durchschmort, die Decke einstürzt oder ein Handwerker grobe Fehler macht – viele dieser Schäden sind nicht explizit versichert. Mit dem Baustein „Unbenannte Gefahren“ sichern Sie sich gegen unerwartete Risiken effektiv ab.
Wenn die Zahlen nicht stimmen – welche Rechte Sie haben und wie Sie korrekt reagieren
Wohnfläche falsch berechnet – was tun?
Nicht jede Wohnflächenangabe ist korrekt – und viele Eigentümer oder Mieter bemerken dies erst, wenn es zu spät ist. Ob im Mietvertrag, Kaufvertrag oder bei der Versicherung: Eine fehlerhafte Quadratmeterangabe kann zu finanziellen Nachteilen, Vertragsstreitigkeiten oder gar Leistungskürzungen führen.
Wenn Sie feststellen, dass die im Vertrag angegebene Wohnfläche von der tatsächlichen Fläche abweicht, sollten Sie zunächst klären, nach welcher Methode die Berechnung erfolgt ist. Im Mietrecht ist – sofern keine andere Methode im Vertrag vereinbart wurde – grundsätzlich die Wohnflächenverordnung (WoFlV) maßgeblich.
Abweichungen bis 10 % gelten als tolerierbar. Liegt die Differenz jedoch darüber, haben Mieter laut aktueller Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil VIII ZR 231/06) das Recht auf Mietminderung, und zwar in Höhe der prozentualen Abweichung. Eine Fläche von 80 m² statt 100 m² erlaubt also eine Reduktion der Miete um 20 % – sogar rückwirkend bis zu drei Jahre.
Bei Eigentum ist die Lage komplexer: Im Kaufvertrag gilt grundsätzlich, was vereinbart wurde. Wird die Fläche aber wesentlich falsch angegeben (z. B. 15 % oder mehr), kann je nach Fall eine Kaufpreisminderung oder sogar Anfechtung wegen arglistiger Täuschung möglich sein – dies bedarf allerdings juristischer Prüfung im Einzelfall.
Im Versicherungsbereich kann eine falsch angegebene Wohnfläche schnell zur Unterversicherung führen. Die Folge: Der Versicherer ersetzt im Schadensfall nur anteilig, oft im Verhältnis von tatsächlicher zu gemeldeter Fläche. Besteht der Verdacht auf falsche Angaben, sollten Sie die Fläche mit einem Fachbetrieb oder Architekten neu berechnen lassen und die Versicherung umgehend informieren. Eine Korrektur ist meist problemlos möglich – bei gravierenden Abweichungen wird ggf. der Beitrag angepasst.
Tipp: Bewahren Sie alle Grundrisspläne, Aufmaßprotokolle und ggf. Architektenunterlagen gut auf. Diese helfen im Streitfall, Ihre Position zu untermauern – gegenüber dem Vermieter, Verkäufer oder der Versicherung.
Quadratmeter allein reichen nicht – so wird Ihre Immobilie richtig bewertet und versichert
Wohnfläche & Versicherungssumme – wie hängt das zusammen?
Die Wohnfläche ist eine wichtige Grundlage – aber sie allein bestimmt nicht die Höhe Ihrer Versicherungssumme. Um Ihre Immobilie realistisch und risikogerecht abzusichern, berücksichtigen Versicherer zusätzlich den Gebäudetyp, die Bauart, das Baujahr und den regionalen Baupreisindex. Nur wenn diese Faktoren korrekt zusammengeführt werden, erhalten Sie den passenden Versicherungsschutz – ohne Unterversicherung oder überhöhte Beiträge.
In der Wohngebäudeversicherung gibt es grundsätzlich zwei Modelle zur Prämienberechnung:
Modell nach Wohnfläche
Modell über den gleitenden Neuwert (Wert 1914)
Beide Ansätze basieren auf der korrekten Angabe der Wohnfläche, unterscheiden sich jedoch stark in der Kalkulation der Versicherungssumme.
Beim Wohnflächenmodell wird die Prämie direkt auf Basis der gemeldeten Quadratmeterzahl berechnet. Je nach Anbieter wird ein pauschaler Betrag pro m² Wohnfläche kalkuliert – z. B. 10–15 € jährlich bei bestimmten Standards. Hier ist die Angabe der Fläche besonders sensibel, da Abweichungen unmittelbar den Beitrag und die Leistung im Schadenfall beeinflussen.
Beim Modell mit gleitender Neuwertversicherung orientieren sich die Versicherer am sogenannten Wert 1914. Dieser ist eine fiktive Berechnungsgröße, die angibt, was der Neubau des Hauses im Jahr 1914 gekostet hätte – multipliziert mit dem aktuellen Baupreisindex ergibt sich daraus die Versicherungssumme. Die Basisdaten (Baujahr, Bauartklasse, Wohnfläche, Ausstattung) werden in eine spezielle Formel eingespeist, oft über ein Wertermittlungsblatt oder Rechner.
Beispiel:
Ein Haus mit 150 m² Wohnfläche, Baujahr 1990, mittlerer Ausstattung ergibt z. B. einen Wert 1914 von 30.000 Mark. Bei einem aktuellen Baupreisindex von 14,7 ergibt sich eine Versicherungssumme von 441.000 €.
Wichtig: Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Der gleitende Neuwert bietet mehr Inflationsschutz und passt sich automatisch an steigende Baukosten an – ist jedoch auch komplexer. Beim Wohnflächenmodell besteht das Risiko einer Unterversicherung, wenn z. B. hochwertig gebaut wurde, aber nur pauschal nach m² abgesichert wird.
Unser Tipp: Lassen Sie Ihre Wohnfläche und Versicherungswerte regelmäßig überprüfen – insbesondere bei älteren Verträgen, Erbschaften oder Umbauten. Nur so vermeiden Sie eine Deckungslücke oder überhöhte Beiträge.
Noch Fragen? Diese Aspekte sollten Sie unbedingt bedenken
Was Sie schon immer über die Wohnflächenberechnung in der Gebäudeversicherung wissen wollten
Was versteht man unter „Wohnflächenberechnung“ im Rahmen einer Gebäudeversicherung?
Die Wohnflächenberechnung legt fest, welche Flächen eines Hauses oder einer Wohnung als versicherte Wohnfläche zugrunde gelegt werden. Sie dient der Festlegung der Versicherungsprämie und kann außerdem Einfluss auf die Leistung im Schadenfall haben (z. B. bei Unterversicherung).
Welche Flächen werden typischerweise zur Wohnfläche angerechnet?
Meist zählen zu der Wohnfläche: Wohn‑, Schlaf‑, Ess‑, Küchen‑, Bad- und Arbeitsräume sowie Hobbyzimmer und beheizbare Wintergärten. Flächen unter Dachschrägen, Balkone, Terrassen, unbeheizte Wintergärten u. a. werden oft anteilig angerechnet oder gar ausgeschlossen, abhängig vom Tarif.
Welche Flächen werden normalerweise nicht (oder nur anteilig) berücksichtigt?
Typischerweise ausgeschlossen sind Kellerräume, Heizungs- und Technikräume, Waschküchen, Garagen, Loggien, Balkone und ungenutzte Dachräume. Bei Dachschrägen werden Flächen mit weniger als 1 Meter lichter Höhe meist nicht gezählt, Flächen zwischen 1 und 2 Metern häufig nur zur Hälfte.
Nach welcher Methode wird in der Gebäudeversicherung die Wohnfläche berechnet?
Viele Versicherer orientieren sich an der Wohnflächenverordnung (WoFlV). Alternativ oder ergänzend kann die DIN 277 herangezogen werden oder eine vom Versicherer individuell definierte Methode. Entscheidend ist, welche Methode in Ihren Versicherungsbedingungen vereinbart ist.
Wie wirken sich Dachschrägen auf die Wohnflächenberechnung aus?
Bei Dachschrägen wird häufig nur der Teil der Fläche berücksichtigt, bei dem eine bestimmte Kopfhöhe (z. B. 1 Meter oder 2 Meter) gegeben ist. Unter einer lichten Höhe von 1 Meter wird meist nichts angerechnet; zwischen 1 und 2 Metern oft zur Hälfte. Flächen ab 2 Metern Höhe werden häufig zu 100 % berücksichtigt. Diese Regelung orientiert sich an der WoFlV.
Was passiert, wenn die Wohnfläche im Antrag falsch angegeben wird?
Wird die Wohnfläche zu niedrig angegeben, kann dies zu einer Unterversicherung führen. Im Schadensfall zahlt der Versicherer dann nur anteilig gemäß dem Verhältnis zwischen angegebener und tatsächlicher Fläche.
Kann ich nach Vertragsabschluss eine nachträgliche Anpassung der Wohnfläche vornehmen?
Ja, in vielen Policen ist eine nachträgliche Anpassung möglich. Bei Umbauten oder Nutzungsänderungen sollten Sie frühzeitig den Versicherer informieren und ggf. einen neuen Vertrag oder Zusatzvertrag abschließen.
Welche Rolle spielt die Wohnfläche bei Tarifen mit „Unterversicherungsverzicht“?
Auch bei Tarifen mit Unterversicherungsverzicht ist die korrekte Angabe der Wohnfläche wichtig: Liegt eine erhebliche Abweichung vor, kann der Versicherer trotz Verzicht Einschränkungen geltend machen oder Leistungsansprüche prüfen.
Gibt es Fälle, in denen ausnahmsweise eine andere Fläche als die Wohnfläche versichert wird?
Ja, in manchen Tarifen oder Sonderkonstruktionen wird statt der Wohnfläche die Versicherungssumme nach Wert 1914 oder eine pauschale Deckung gewählt, bei der die Wohnfläche nicht oder nur sekundär einfließt. In solchen Fällen ist die Wohnflächenangabe weniger direkt ausschlaggebend.
Was sollte ich tun, bevor ich den Antrag für eine Gebäudeversicherung abschließe?
Klären Sie, nach welcher Berechnungsmethode Ihr Versicherer die Wohnfläche verlangt. Führen Sie eine exakte Vermessung durch oder nutzen Sie Baupläne/Genehmigungen als Ausgangspunkt. Dokumentieren Sie Ihre Berechnung, um späteren Unstimmigkeiten vorzubeugen.
Das könnte Sie auch interessieren
Die Wohnfläche ist ein zentraler Faktor – doch sie steht in engem Zusammenhang mit anderen Kennzahlen Ihrer Gebäudeversicherung. Ob Versicherungswert, gleitender Neuwert oder die Frage, wer bei Eigentümerwechsel oder Steuerabrechnung zuständig ist: Die folgenden Themen liefern Ihnen zusätzliche Orientierung für fundierte Entscheidungen rund um Ihre Absicherung.

Der Wert 1914 ist die Basis für viele gleitende Neuwertversicherungen. Er beschreibt, was Ihr Haus im Jahr 1914 gekostet hätte – unabhängig von heutigen Preisen. Multipliziert mit dem aktuellen Baupreisindex ergibt sich daraus die Versicherungssumme. Eine korrekte Ermittlung schützt vor Unterversicherung.

Diese Versicherungsform passt sich automatisch an steigende Baupreise an. So bleibt der Versicherungsschutz immer auf dem aktuellen Stand. Grundlage ist der Wert 1914 in Kombination mit dem Baupreisindex. Besonders sinnvoll bei langfristigen Verträgen oder stark schwankenden Baukosten.
Zusammenfassung
Die Wohnfläche ist weit mehr als nur eine Zahl im Bauplan – sie bildet die Grundlage für viele rechtliche, finanzielle und versicherungstechnische Entscheidungen rund um Ihre Immobilie. Ob bei der Beitragsberechnung Ihrer Wohngebäudeversicherung, der Ermittlung des Versicherungsschutzes oder der Berechnung von Nebenkosten: Eine korrekte Angabe ist entscheidend, um Unterversicherung, Streitigkeiten und unnötige Kosten zu vermeiden. Dabei spielen nicht nur die tatsächlichen Quadratmeter, sondern auch die zugrunde liegende Berechnungsmethode – etwa nach Wohnflächenverordnung oder DIN 277 – eine zentrale Rolle. Wer seine Versicherung optimal abstimmen will, sollte daher regelmäßig prüfen, ob die hinterlegte Wohnfläche noch aktuell ist, mit welcher Methode sie ermittelt wurde und ob alle baulichen Veränderungen berücksichtigt sind. So stellen Sie sicher, dass Ihr Zuhause nicht nur baulich, sondern auch finanziell gut abgesichert ist.
Häufige Fragen
Wer darf die Wohnfläche offiziell vermessen (z. B. Architekt, Sachverständiger)?
In der Regel dürfen sowohl Architekten, Vermessungsingenieure als auch öffentlich bestellte Sachverständige die Wohnfläche professionell ermitteln. Diese Gutachten sind besonders wichtig, wenn eine exakte und rechtssichere Angabe erforderlich ist.
Welche Bedeutung hat die Wohnflächenangabe für die Hausratversicherung im Vergleich zur Gebäudeversicherung?
In der Hausratversicherung spielt oft die Wohnfläche eine Rolle bei der Einschätzung des Hausratvolumens, aber hier dominieren meist die Versicherungssumme und Deckungsgrenzen. Die Konsequenzen fehlerhafter Flächenangaben sind jedoch ähnlich – im Schadenfall kann eine Kürzung erfolgen.
Wie beeinflussen lokale Bauvorschriften oder Landesregeln die Wohnflächenberechnung?
Einige Bundesländer legen durch Landesbauordnungen oder Landesverordnungen zusätzliche Vorgaben fest, welche Flächen wie zu behandeln sind (z. B. Dachräume, Loggien). In solchen Fällen kann die dort festgelegte Regelung Vorrang haben oder ergänzend wirken.
Was kann ich tun, wenn Versicherer widersprüchliche Anweisungen zur Flächenberechnung geben?
Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, nach welcher Methode Ihr Vertrag berechnet wird. Dokumentieren Sie Ihre eigene Berechnung transparent. Bei Unstimmigkeiten können Sie auf Musterbedingungen (z. B. GDV‑Vorgaben) verweisen oder eine unabhängige Prüfung durch einen Gutachter in Betracht ziehen.

