Krankheiten, die zur Erwerbsminderungsrente führen
Erfahren Sie, welche Erkrankungen besonders häufig zur Erwerbsminderung führen – und wie Sie vorsorgen können

Ob psychische Belastung, chronische Schmerzen oder schwerwiegende Diagnosen: Wenn Ihre Gesundheit Sie dauerhaft daran hindert, einer geregelten Arbeit nachzugehen, kann die Erwerbsminderungsrente zu einer wichtigen finanziellen Stütze werden. Doch nicht jede Erkrankung führt automatisch zum Anspruch – und nicht jeder Antrag wird bewilligt. Wir zeigen Ihnen, welche Krankheiten häufig zur Erwerbsminderungsrente führen, worauf bei der Antragstellung zu achten ist und wie Sie Ihre Chancen realistisch einschätzen können. Unsere Übersicht basiert auf aktuellen Daten der Deutschen Rentenversicherung und berücksichtigt die häufigsten Ursachen aus medizinischer und statistischer Sicht.
Das Wichtigste auf einem Blick
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
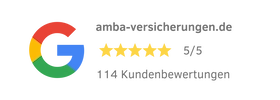
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Wer dauerhaft weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, sollte seine Rechte und Pflichten genau kennen.
Voraussetzungen, Krankheiten und Chancen auf Erwerbsminderungsrente
Nicht jede Erkrankung führt automatisch zu einem Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Entscheidend ist, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben eingeschränkt ist – dauerhaft und nachweislich. Die gesetzliche Rentenversicherung prüft dabei nicht nur die Diagnose, sondern auch die Auswirkungen auf Ihre individuelle Arbeitsfähigkeit. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, welche Krankheiten besonders häufig zur Anerkennung führen, warum viele Anträge scheitern und wie Sie sich optimal vorbereiten können.
Um Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente zu haben, müssen zwei große Bereiche erfüllt sein: die medizinischen Voraussetzungen und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.
1. Medizinische Voraussetzungen:
Sie müssen nachweislich aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr in der Lage sein, einer beruflichen Tätigkeit in vollem Umfang nachzugehen.
Volle Erwerbsminderung: Wenn Sie weniger als 3 Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können.
Teilweise Erwerbsminderung: Wenn Sie zwischen 3 und 6 Stunden täglich arbeiten können.
Diese Einschätzung erfolgt auf Basis ärztlicher Gutachten – u. a. durch Haus- oder Fachärzte sowie den sozialmedizinischen Dienst der Deutschen Rentenversicherung.
2. Versicherungsrechtliche Voraussetzungen:
Damit eine Erwerbsminderungsrente bewilligt werden kann, müssen Sie:
mindestens 5 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert gewesen sein („Wartezeit“), und
in den letzten 5 Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Monate Pflichtbeiträge gezahlt haben.
Ausnahmen gelten für Menschen mit Behinderung, Berufseinsteiger oder besondere Konstellationen (z. B. Rehabilitationsträger).
Nicht die Diagnose selbst entscheidet über den Anspruch – sondern die daraus resultierende Einschränkung Ihrer Arbeitsfähigkeit. Dennoch gibt es Erkrankungen, die statistisch deutlich häufiger zu einer Bewilligung führen:
Psychische Erkrankungen (z. B. Depressionen, Angststörungen, Anpassungsstörungen) – rund ein Drittel aller Fälle
Orthopädische Leiden (z. B. Bandscheibenvorfälle, schwere Arthrosen, Wirbelsäulenversteifungen)
Onkologische Erkrankungen (z. B. Brustkrebs, Leukämien, Prostatakarzinome)
Neurologische Krankheiten (z. B. Multiple Sklerose, Parkinson, Epilepsie)
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt, Kardiomyopathien)
Lungenerkrankungen (z. B. COPD, chronisches Asthma)
Autoimmun- und Magen-Darm-Erkrankungen (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
Suchterkrankungen (z. B. Alkohol‑, Medikamenten- oder Drogensucht)
Besonders häufig genehmigt werden Anträge, wenn mehrere Diagnosen gleichzeitig vorliegen und sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken („Multimorbidität“).
Die Ablehnungsquote ist hoch: Rund die Hälfte aller Erstanträge auf Erwerbsminderungsrente wird abgelehnt. Häufige Gründe sind:
Nicht erfüllte Wartezeit: Die geforderten 5 Versicherungsjahre oder 36 Monate Pflichtbeiträge fehlen.
Unzureichende Nachweise: Fehlende oder widersprüchliche medizinische Gutachten.
Abweichende Einschätzung durch Amtsärzte: Diese kommen oft zu anderen Ergebnissen als die behandelnden Ärzte.
Fehlende Mitwirkung: Gutachtertermine werden versäumt oder Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht.
Eingeschränkte, aber nicht „ausreichende“ Einschränkung: Wenn z. B. eine Erwerbsfähigkeit von 6 Stunden täglich angenommen wird, besteht kein Anspruch.
Ein Widerspruch ist möglich – und nicht selten erfolgreich, wenn ergänzende medizinische Unterlagen vorgelegt werden.

Ein gut vorbereiteter Antrag erhöht die Chancen erheblich – insbesondere bei komplexen oder psychischen Krankheitsverläufen.
Diese Punkte sollten Sie beachten:
Frühzeitig Kontenklärung veranlassen – bevor der Antrag gestellt wird
Lückenlose Krankengeschichte dokumentieren, idealerweise tabellarisch
Ärztliche Befunde und Reha-Berichte in Kopie beilegen
Online-Antrag nutzen (eAntrag der Deutschen Rentenversicherung) oder Unterstützung durch Beratungsstellen in Anspruch nehmen
Termin beim sozialmedizinischen Gutachter unbedingt wahrnehmen
Bei Ablehnung: Widerspruch fristgerecht einreichen – Begründung kann später folgen
Auf Akteneinsicht bestehen, um Gutachten und Einschätzungen prüfen zu können
Eine erfolgreiche Antragstellung erfordert Zeit, Geduld – und vor allem eine strategische Vorbereitung.
Nicht jede Diagnose reicht – entscheidend ist, wie stark sie Ihren Alltag und Beruf einschränkt.
Häufige Krankheitsbilder bei der Erwerbsminderungsrente
Viele Erkrankungen können die Leistungsfähigkeit im Beruf dauerhaft einschränken – manche so stark, dass eine Erwerbsminderung eintritt. Die häufigsten Ursachen betreffen in Deutschland psychische, orthopädische und onkologische Krankheitsverläufe. Doch auch Herz‑, Lungen- und neurologische Leiden führen in vielen Fällen zur Antragstellung. Entscheidend ist dabei immer, wie sehr die Erkrankung Ihre Arbeitsfähigkeit einschränkt – und ob dies durch ärztliche Gutachten belegt werden kann. In der Praxis spielen Mehrfachdiagnosen, chronische Verläufe und psychische Belastung eine zentrale Rolle bei der Entscheidung der Rentenversicherung.
Die Deutsche Rentenversicherung prüft bei jedem Antrag individuell, in welchem Umfang eine Erkrankung die berufliche Tätigkeit einschränkt. Besonders häufig betroffen sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie Depressionen oder Anpassungsstörungen. Auch orthopädische Beschwerden, etwa Bandscheibenvorfälle oder fortgeschrittene Arthrose, führen regelmäßig zu einer Reduktion der Erwerbsfähigkeit. Krebserkrankungen – insbesondere bei laufender Therapie oder irreversiblen Schädigungen – sind ebenfalls ein häufiger Grund für die volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente.
Hinzu kommen neurologische Leiden wie Multiple Sklerose oder Parkinson, die oft schleichend beginnen, aber im Verlauf die körperliche Belastbarkeit stark reduzieren. Auch Erkrankungen der Lunge – etwa bei COPD oder schwerem Asthma – führen durch die reduzierte Belastbarkeit im Alltag zur Unfähigkeit, mehrere Stunden täglich zu arbeiten. Die Einschätzung erfolgt dabei nicht nur anhand der Diagnose, sondern auch anhand der dokumentierten Auswirkungen auf Konzentration, Beweglichkeit, psychische Stabilität oder Belastungsfähigkeit.
In der Praxis werden die meisten Anträge genehmigt, wenn:
eine chronische Erkrankung besteht,
mehrere Diagnosen in Kombination auftreten („Multimorbidität“) oder
der Leidensdruck langfristig und objektivierbar dokumentiert ist.
Nachfolgend zeigen wir Ihnen drei häufige Krankheitsbilder, die in der Statistik der Deutschen Rentenversicherung regelmäßig mit einem positiven Bescheid zur Erwerbsminderungsrente verbunden sind.
Psychische Erkrankungen
Mehr als ein Drittel aller bewilligten Erwerbsminderungsrenten gehen auf Depressionen, Angststörungen oder psychosomatische Leiden zurück. Besonders betroffen sind Menschen mit wiederkehrenden Episoden, Anpassungsstörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Rentenversicherung prüft hier genau, ob trotz Therapie eine dauerhafte Einschränkung der psychischen Belastbarkeit vorliegt.
Orthopädische Erkrankungen
Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Bandscheibenvorfälle, starke Arthrosen oder Versteifungen der Wirbelsäule zählen zu den häufigsten körperlichen Ursachen. Sie führen oft zu starken Bewegungseinschränkungen, Schmerzen unter Belastung und damit zur dauerhaften Reduktion der Arbeitsfähigkeit – insbesondere bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten.
Krebserkrankungen
Krebs ist nicht nur akut, sondern auch langfristig eine Belastung. Patienten mit Tumorerkrankungen – etwa Brustkrebs, Leukämie oder Prostatakarzinom – leiden oft an Folgeproblemen wie Fatigue, Konzentrationsstörungen oder körperlicher Schwäche. Diese Langzeitfolgen können die Erwerbsfähigkeit stark einschränken, auch wenn die Erkrankung selbst in Remission ist.
Ein erfolgreicher Antrag beginnt mit guter Vorbereitung – und dem richtigen Verständnis für den Ablauf.
Erwerbsminderungsrente beantragen – so gehen Sie richtig vor
Die Beantragung der Erwerbsminderungsrente ist ein komplexer Prozess, der Geduld, Genauigkeit und rechtzeitiges Handeln erfordert. Viele Betroffene unterschätzen, wie aufwendig die Antragstellung ist – und warum die Ablehnungsquote so hoch ausfällt. Wer sich frühzeitig informiert, notwendige Unterlagen sorgfältig zusammenstellt und ärztliche Nachweise gezielt ergänzt, verbessert seine Chancen erheblich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen – und worauf es besonders ankommt.
Der Antrag auf Erwerbsminderungsrente sollte möglichst frühzeitig vorbereitet werden – idealerweise ab dem Zeitpunkt, an dem sich abzeichnet, dass Ihre Erkrankung langfristig die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt. Spätestens sechs Monate nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit kann die Rente beantragt werden, wenn die Arbeitsfähigkeit unter sechs Stunden pro Tag liegt. Vorher zahlt in der Regel die Krankenkasse Krankengeld.
Der erste Schritt ist die sogenannte Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung. Dabei wird geprüft, ob alle Versicherungszeiten vollständig und korrekt erfasst sind. Fehlende Zeiten sollten ergänzt werden – dies betrifft z. B. Schulzeiten, Kindererziehungszeiten oder Arbeitslosenzeiten.
Anschließend erfolgt die formale Antragstellung. Diese kann digital per eAntrag oder in Papierform erfolgen. Wichtig ist eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation Ihrer Krankengeschichte. Dazu gehören:
eine tabellarische Übersicht aller Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte, Reha-Maßnahmen und Behandlungen
ärztliche Gutachten und Befunde, möglichst mit Angaben zur Leistungsfähigkeit im Alltag und Beruf
Nachweise der Krankenkasse, z. B. über gezahltes Krankengeld
Angaben zu früheren Tätigkeiten, Versicherungsnummer, Bankverbindung, Steuer-ID etc.
Nach Eingang des Antrags erfolgt eine Einladung zur Begutachtung durch den Amtsarzt. Dieser kann die Einschätzung Ihrer behandelnden Ärzte bestätigen oder – was häufig vorkommt – anders bewerten. Gerade bei psychischen Erkrankungen wird im Gespräch auf Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit und emotionale Stabilität geachtet.
Ein häufiger Fehler ist die unvollständige Mitwirkung: Wer Gutachtertermine versäumt oder Unterlagen nicht fristgerecht einreicht, riskiert eine Ablehnung. Deshalb gilt: sorgfältig arbeiten, Fristen einhalten und bei Unsicherheiten frühzeitig fachlichen Rat einholen – zum Beispiel über die Beratungsangebote der Deutschen Rentenversicherung, Sozialverbände oder erfahrene Rentenberater.
Wichtig: Selbst wenn der Antrag abgelehnt wird, bestehen gute Chancen auf Bewilligung im Widerspruchsverfahren – sofern neue oder bisher nicht bewertete medizinische Fakten eingebracht werden. Auch ein Klageweg vor dem Sozialgericht ist zulässig und oft erfolgreich, wenn externe Gutachter Ihre Sicht bestätigen.
Drei zentrale Themen, die beim Verständnis der Erwerbsminderungsrente nicht fehlen dürfen.
Das sollten Sie ebenfalls wissen
Wer sich mit der Erwerbsminderungsrente beschäftigt, stößt schnell auf weitere wichtige Themen: Wie funktioniert die gesetzliche Rentenversicherung? Was genau unterscheidet Erwerbsminderung von Erwerbsunfähigkeit? Und welche Leistungen stehen überhaupt zur Verfügung? Die folgenden Themen helfen Ihnen, das System besser zu verstehen – und zeigen Alternativen und Ergänzungen auf, die gerade für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen relevant sind.
Gesetzliche Rentenversicherung

Die Erwerbsminderungsrente ist eine Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Wer lange genug Beiträge eingezahlt hat und gesundheitlich dauerhaft eingeschränkt ist, kann daraus finanzielle Unterstützung erhalten. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und was Sie bei der Antragstellung beachten sollten, erfahren Sie hier.
Erwerbsminderungsrente

Wer weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, hat unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Doch die Hürden sind hoch – und viele Anträge scheitern an Details. Wir zeigen, wann ein Anspruch besteht, wie die Rente berechnet wird und was bei der Antragstellung wichtig ist.
Erwerbsunfähigkeitsversicherung

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht oft nicht aus, um den Lebensstandard zu sichern. Eine private Erwerbsunfähigkeitsversicherung kann hier Abhilfe schaffen. Sie greift unabhängig von der gesetzlichen Rente – und zahlt, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr arbeiten können. Wir erklären, wie sie funktioniert und worauf Sie achten sollten.
Wird der Antrag abgelehnt, beginnt für viele erst der entscheidende Teil des Verfahrens.
Was tun bei Ablehnung der Erwerbsminderungsrente?
Rund jeder zweite Antrag auf Erwerbsminderungsrente wird zunächst abgelehnt – selbst wenn gesundheitliche Einschränkungen bestehen. Für Betroffene ist das oft frustrierend, aber kein Grund aufzugeben. Denn die Gründe für Ablehnungen sind vielfältig – und ein Widerspruch kann erfolgreich sein, wenn gezielt reagiert wird. Wer jetzt systematisch vorgeht, neue Gutachten einholt und die Akteneinsicht nutzt, hat gute Chancen auf eine nachträgliche Bewilligung. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte jetzt sinnvoll sind – und wie Sie dabei vorgehen sollten.
Eine Ablehnung der Erwerbsminderungsrente ist keine Seltenheit – aber auch kein endgültiges Urteil. Viele Anträge scheitern nicht an der medizinischen Einschätzung, sondern an formalen Kriterien, fehlenden Unterlagen oder widersprüchlichen Gutachten. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Ablehnungsbegründung – und eine strukturierte Vorgehensweise im Widerspruchsverfahren.
1. Ablehnungsbescheid sorgfältig prüfen
Jeder Ablehnungsbescheid enthält eine Begründung. Darin wird aufgeführt, ob es an der versicherungsrechtlichen Voraussetzung mangelt (z. B. fehlende Pflichtbeiträge), ob die medizinische Einschätzung nicht ausreicht oder ob die Unterlagen unvollständig waren.
2. Widerspruch fristgerecht einlegen
Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab Zugang des Bescheids. Wichtig: Der Widerspruch muss nicht sofort begründet werden – ein einfacher formaler Hinweis genügt zunächst („Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] ein.“).
3. Akteneinsicht beantragen
Die Akteneinsicht ist Ihr Recht. Sie ermöglicht es, die verwendeten ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen der Rentenversicherung zu prüfen. Gerade bei Diskrepanzen zwischen Hausarzt und Amtsarzt lohnt sich dieser Schritt.
4. Ergänzende medizinische Unterlagen nachreichen
Besorgen Sie sich neue oder ergänzende Gutachten – insbesondere von Fachärzten oder spezialisierten Therapeuten. Auch Reha-Berichte und aktuelle Atteste können entscheidend sein, um den Gesundheitszustand realistisch darzustellen.
5. Sozialverband oder Rentenberater einschalten
Erfahrene Berater können beim Widerspruch helfen, Fristen überwachen und den Schriftverkehr übernehmen. In manchen Fällen ist auch die Hilfe eines Fachanwalts für Sozialrecht sinnvoll.
6. Klage vor dem Sozialgericht – wenn nötig
Wird auch der Widerspruch abgelehnt, bleibt der Rechtsweg. Eine Klage vor dem Sozialgericht ist kostenfrei und eröffnet die Möglichkeit, unabhängige Gutachter einzuschalten. Viele Fälle werden bereits vor dem Urteil durch Vergleich entschieden – oft zugunsten der Versicherten.
Wichtig: Wer den Antrag nicht durchkämpft, verzichtet womöglich dauerhaft auf Ansprüche. Gerade bei psychischen Erkrankungen oder komplexen Krankheitsbildern lohnt sich der Einsatz – mit Geduld, fachlicher Unterstützung und klarem Fokus auf die Nachweise.
Zwei Begriffe – zwei völlig unterschiedliche Absicherungen.
Unterschied zwischen Erwerbsminderung und Erwerbsunfähigkeit – was Sie wissen sollten
Wer durch Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kann, stößt schnell auf zwei Begriffe: Erwerbsminderung und Erwerbsunfähigkeit. Sie klingen ähnlich – stehen aber für zwei unterschiedliche Regelungen. Während die Erwerbsminderungsrente eine gesetzliche Leistung ist, handelt es sich bei der Erwerbsunfähigkeit meist um eine private Versicherungslösung. Warum das für Ihre finanzielle Sicherheit einen großen Unterschied macht und worauf Sie achten sollten, lesen Sie hier.
Die Erwerbsminderungsrente ist eine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie wird gezahlt, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft weniger als sechs Stunden täglich arbeiten können – egal in welchem Beruf. Dabei gelten strenge Voraussetzungen: Fünf Jahre Versicherungszeit und mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung. Die Höhe dieser Rente ist häufig niedrig und reicht selten aus, um den gewohnten Lebensstandard zu sichern.
Die Erwerbsunfähigkeit im klassischen Sinne ist dagegen ein Begriff aus der privaten Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Hier geht es um den Verlust der Fähigkeit, überhaupt irgendeine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszuüben – unabhängig von Alter, Ausbildung oder bisherigem Beruf. Diese Absicherung kann freiwillig abgeschlossen werden und tritt in Kraft, wenn die versicherte Person voraussichtlich dauerhaft keiner Tätigkeit mehr nachgehen kann.
Wichtiger Unterschied:
Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente erfordert deutliche Einschränkungen und ist an gesetzlich geregelte Bedingungen gebunden. Eine private Erwerbsunfähigkeitsversicherung hingegen kann flexibler und schneller leisten – je nach Vertragsbedingungen sogar rückwirkend oder bei weniger strengen medizinischen Anforderungen.
Gerade für Selbstständige, Freiberufler und Menschen ohne ausreichende Rentenansprüche kann eine private Absicherung entscheidend sein, um im Fall einer schweren Erkrankung nicht in finanzielle Not zu geraten.
Die gesetzliche Rente ist ein Basis-Schutz – mehr aber nicht. Wer langfristig vorsorgen möchte, sollte prüfen, ob eine private Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll ist, um Versorgungslücken gezielt zu schließen.
Diese Themen helfen Ihnen, Ihr Einkommen, Ihre Gesundheit und Ihre Zukunft besser abzusichern.
Weitere wichtige Absicherungen bei Krankheit und Erwerbsminderung
Wer durch Krankheit beruflich eingeschränkt ist, steht oft vor weiteren Herausforderungen – finanziell, gesundheitlich und organisatorisch. Neben der Erwerbsminderungsrente gibt es weitere Absicherungsmöglichkeiten, die helfen können, Versorgungslücken zu vermeiden und Risiken abzufedern. Die folgenden Themen geben Ihnen einen Überblick über sinnvolle Ergänzungen rund um Einkommen, Vorsorge und Schutz bei dauerhafter Einschränkung der Arbeitsfähigkeit.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung greift deutlich früher als die Erwerbsminderungsrente – und zahlt bereits, wenn Sie in Ihrem zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten können. Gerade für Berufstätige mit Verantwortung oder höherem Einkommen ist sie eine unverzichtbare Ergänzung zur gesetzlichen Absicherung.

Krankentagegeldversicherung
Längere Krankheiten führen schnell zu finanziellen Einbußen. Ein Krankentagegeld schließt die Lücke nach Ablauf der Lohnfortzahlung – und sorgt dafür, dass laufende Kosten gedeckt sind. Besonders Selbstständige und Freiberufler profitieren von dieser gezielten Absicherung bei Verdienstausfall.
Weitere Themen rund um Absicherung & Vorsorge
Vertiefende Antworten auf Fragen, die viele Betroffene erst im Verlauf des Antragsverfahrens stellen.
Was Sie schon immer über die Erwerbsminderungsrente wissen wollten
Kann ich auch bei mehreren Krankheiten gleichzeitig Erwerbsminderungsrente erhalten?
Ja, und genau das ist sogar häufig der Fall. Die Rentenversicherung spricht dann von „multifaktorieller Einschränkung“. Wenn mehrere Diagnosen – z. B. orthopädische und psychische – zusammenspielen und sich gegenseitig verstärken, steigen die Chancen auf eine Anerkennung. Wichtig ist, dass alle Erkrankungen gut dokumentiert sind.
Muss ich jede zumutbare Tätigkeit annehmen, um die Rente zu vermeiden?
Nein. Die Rentenversicherung prüft, ob Sie grundsätzlich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch einsetzbar sind – nicht, ob Sie in Ihrem erlernten Beruf arbeiten können. Allerdings darf jede Tätigkeit berücksichtigt werden, sofern sie realistisch durchführbar ist und keine Überforderung darstellt. Eine Pflicht zur beruflichen Umschulung besteht jedoch nicht automatisch.
Wie lange wird die Erwerbsminderungsrente in der Regel gewährt?
Die Rente wird meist zunächst befristet für drei Jahre bewilligt. Sie kann verlängert werden, wenn der Gesundheitszustand gleich bleibt oder sich verschlechtert. Nur in Ausnahmefällen – z. B. bei dauerhaften, unheilbaren Erkrankungen – wird die Rente unbefristet gewährt.
Hat eine Reha-Maßnahme Einfluss auf meinen Rentenantrag?
Ja. Die Rentenversicherung prüft nach dem Grundsatz „Reha vor Rente“, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation Ihre Erwerbsfähigkeit wiederherstellen kann. Eine abgebrochene oder abgelehnte Reha-Maßnahme kann sich negativ auf Ihren Antrag auswirken. Wer krankheitsbedingt nicht teilnehmen kann, muss dies gut begründen und belegen.
Wird meine Erwerbsminderungsrente bei anderen Einkünften gekürzt?
Ja – bei beiden Formen der Erwerbsminderungsrente gelten feste Hinzuverdienstgrenzen, deren Überschreitung zu einer Kürzung der Rente führen kann. Die Regelungen unterscheiden sich jedoch deutlich:
✔️ Volle Erwerbsminderungsrente:
Sie dürfen im Jahr 2025 bis zu 19.661,25 Euro brutto hinzuverdienen – steuerlich und sozialversicherungspflichtig. Dabei spielt es keine Rolle, wie Sie den Verdienst auf das Jahr verteilen. Sie können z. B. jeden Monat 1.638,44 Euro verdienen oder in einem Monat 19.661,25 Euro und im Rest des Jahres nichts. Ein Überschreiten dieser Grenze führt zu einer Anrechnung – 40 % des übersteigenden Betrags werden von Ihrer Rente abgezogen.
✔️ Teilweise Erwerbsminderungsrente:
Hier liegt die Mindest-Hinzuverdienstgrenze 2025 bei 39.322,50 Euro brutto jährlich. Diese Grenze wird individuell berechnet – auf Basis Ihres höchsten Bruttojahresverdienstes innerhalb der letzten 15 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung. Auch hier gilt: 40 % des Betrags, der über der Grenze liegt, werden von der Rente abgezogen.
Hinweis:
Die Rentenversicherung prüft jährlich, ob Ihre Angaben stimmen. Eine Mitteilungspflicht besteht – Sie müssen jeden Nebenverdienst angeben. Bei Verstößen drohen Rückforderungen. Lassen Sie sich im Zweifel individuell beraten – besonders dann, wenn Sie mehrere Einkommensquellen haben.
Was passiert mit der Erwerbsminderungsrente, wenn ich das Rentenalter erreiche?
Mit Erreichen der Regelaltersgrenze wird die Erwerbsminderungsrente automatisch in eine Altersrente umgewandelt. Die Höhe bleibt in der Regel gleich – sie wird aber dann nicht mehr an gesundheitliche Voraussetzungen geknüpft. Eine gesonderte Beantragung ist nicht nötig.
Zusammenfassung
Die Erwerbsminderungsrente ist eine wichtige Absicherung für Menschen, deren gesundheitliche Situation die Berufstätigkeit dauerhaft einschränkt. Entscheidend ist jedoch nicht die Diagnose allein, sondern das tatsächliche Maß an Einschränkung. Besonders häufig anerkannt werden psychische Erkrankungen, orthopädische Leiden und Krebserkrankungen – aber auch viele andere Diagnosen können zum Anspruch führen. Wer sich frühzeitig informiert, den Antrag strukturiert vorbereitet und sich bei einer Ablehnung nicht entmutigen lässt, hat gute Chancen auf Bewilligung. Eine ergänzende private Absicherung kann sinnvoll sein, um finanzielle Lücken zu schließen. Wir helfen Ihnen, Ihre Möglichkeiten zu erkennen und die nächsten Schritte zu planen.
häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Erwerbsminderungsrente und Berufsunfähigkeitsrente?
Die Erwerbsminderungsrente ist eine gesetzliche Leistung und hängt davon ab, wie viele Stunden täglich Sie noch arbeiten können. Die Berufsunfähigkeitsrente ist dagegen meist eine private Absicherung, die schon greift, wenn Sie Ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können – auch wenn Sie theoretisch noch in einem anderen Bereich arbeiten könnten.
Wie lange dauert es, bis über meinen Antrag entschieden wird?
Die Bearbeitungsdauer liegt im Schnitt zwischen 3 und 6 Monaten. Je vollständiger und nachvollziehbarer Ihr Antrag gestellt wurde, desto schneller erfolgt die Entscheidung. Bei Rückfragen oder fehlenden Unterlagen verlängert sich die Bearbeitungszeit deutlich.
Muss ich eine Reha machen, bevor ich Erwerbsminderungsrente bekomme?
Nicht zwingend, aber in vielen Fällen wird vor der Rentenbewilligung geprüft, ob eine Reha-Maßnahme helfen kann. Das Prinzip „Reha vor Rente“ bedeutet, dass Sie gegebenenfalls zu einer medizinischen oder beruflichen Reha verpflichtet werden, wenn Aussicht auf Verbesserung besteht.
Wie oft wird die Erwerbsminderungsrente überprüft?
In der Regel wird die Rente zunächst befristet gewährt und nach drei Jahren erneut geprüft. Bei dauerhafter Einschränkung kann eine unbefristete Rente bewilligt werden. Auch dann kann die Rentenversicherung stichprobenartig oder anlassbezogen neue Gutachten verlangen.

