Gebäudeschaden auszahlen lassen – wann es sinnvoll ist und was gilt
Sie möchten sich einen Gebäudeschaden auszahlen lassen? Erfahren Sie hier, wann das geht und worauf Sie achten müssen

Ein Schaden am eigenen Haus ist belastend – doch die eigentliche Herausforderung beginnt oft erst mit der Abwicklung. Welche Schritte sind jetzt nötig? Welche Nachweise verlangt die Versicherung? Und welche Auszahlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt?
Mit dem richtigen Vorgehen sichern Sie sich nicht nur Ihre Ansprüche, sondern auch eine schnelle und faire Regulierung. Auf dieser Seite erfahren Sie, was bei der Schadenmeldung und Auszahlung zu beachten ist – klar, verständlich und auf dem neuesten Stand.
Das Wichtigste auf einem Blick
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
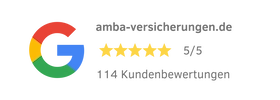
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Grundlage für jede Auszahlung im Schadenfall
Was ist eine Wohngebäudeversicherung
Die Wohngebäudeversicherung schützt Immobilieneigentümer vor den finanziellen Folgen verschiedenster Schäden – z. B. durch Sturm, Leitungswasser oder Feuer. Sie kommt für die Reparatur, den Wiederaufbau oder den Wertersatz beschädigter Gebäudeteile auf. Voraussetzung für eine Auszahlung ist jedoch, dass der Schaden unter die versicherten Gefahren fällt und korrekt gemeldet wurde. Ebenso entscheidend: die Höhe der Versicherungssumme und die Einhaltung vertraglicher Pflichten.
Je nach Tarif und Schadenart erhalten Sie als Versicherungsnehmer eine Erstattung der Wiederherstellungskosten, eine Entschädigung zum Zeitwert oder eine sogenannte fiktive Abrechnung. Wichtig ist es, die Unterschiede zu kennen – damit Sie Ihre Ansprüche im Ernstfall richtig durchsetzen können.
Die Wohngebäudeversicherung deckt Schäden an festen Bestandteilen eines Gebäudes ab – also an allem, was mit dem Haus „verwachsen“ ist. Dazu gehören Dach, Fenster, Fassade, Böden, Wände, Heizungsanlagen und fest installierte technische Einrichtungen. Entscheidend ist, dass die Schadenursache versichert ist – etwa ein Rohrbruch, ein Sturm oder Hagelschlag.
Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer, Leitungswasser, Blitz
Zerstörung oder Beschädigung von Dach, Fassade, Mauerwerk
Einbruchbedingte Gebäudeschäden (z. B. aufgebrochene Türen/Fenster)
Schäden an Nebengebäuden, sofern eingeschlossen
Kosten für Reparatur, Wiederherstellung oder Wertersatz
Nicht alle Schäden sind automatisch mitversichert. Ausschlüsse und Einschränkungen betreffen oft Fälle, in denen Wartungspflichten verletzt wurden oder der Schaden außerhalb der versicherten Gefahren liegt. Auch bewegliche Gegenstände im Haus – wie Möbel, Technik oder Kleidung – sind nicht durch die Wohngebäude‑, sondern durch die Hausratversicherung geschützt.
Schäden durch normale Abnutzung oder mangelhafte Instandhaltung
Bewegliche Güter (z. B. Möbel, Elektronik) – diese sind nur über die Hausratversicherung versichert
Schäden durch Rückstau/Überschwemmung ohne Elementarschadenschutz
Vorsätzlich herbeigeführte Schäden oder grobe Fahrlässigkeit
Unzureichend dokumentierte oder verspätet gemeldete Schäden
Der erste Schritt zur Auszahlung: korrektes Verhalten nach dem Schaden
Schaden dokumentieren, melden – und korrekt einreichen
Nur wer seinen Schaden lückenlos dokumentiert und fristgerecht meldet, sichert sich die volle Erstattung durch die Wohngebäudeversicherung
Sobald ein Gebäudeschaden auftritt – sei es durch Sturm, Rohrbruch oder Feuer – gilt: schnell handeln, aber nichts überstürzen. Melden Sie den Schaden umgehend Ihrer Versicherung – am besten telefonisch oder über das Online-Schadenformular. Halten Sie alle relevanten Informationen bereit: Schadentag, betroffene Gebäudeteile, erste Einschätzung zur Schadenshöhe.
Parallel ist eine gründliche Dokumentation entscheidend. Fotografieren Sie den Schaden aus mehreren Perspektiven, am besten mit Zeitstempel. Auch Videos, Skizzen oder Listen der betroffenen Bauteile erhöhen die Nachvollziehbarkeit. Bei Leitungswasserschäden sollten z. B. Wanddurchfeuchtungen, nasse Böden oder Tropfspuren eindeutig erkennbar sein.
Wichtig: Verändern Sie den Schadensort zunächst nicht. Erst nach Rücksprache mit der Versicherung oder einem Gutachter dürfen Reparaturen beginnen. Nur Notmaßnahmen – etwa das Abdecken eines undichten Dachs oder das Entfernen von Gefahrenquellen – sind sofort erlaubt. Diese Maßnahmen dienen der Schadenminderungspflicht und müssen ebenfalls dokumentiert werden.
Checkliste: Das müssen Sie tun
📞 Schaden unverzüglich melden – per Telefon oder Onlineformular
📸 Fotos & Videos anfertigen – aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Zeitangabe
📝 Aufstellung der Schäden erstellen – ggf. mit Skizzen und Beschreibung
🔒 Schadensort sichern und nicht verändern – außer zur Gefahrenabwehr
🛠️ Notmaßnahmen nur nach Absprache – oder sofort bei akuter Gefahr
🧾 Unterlagen sammeln – Versicherungsschein, frühere Reparaturbelege, ggf. Zeugenaussagen
Was zählt bei der Bewertung – und wie viel Einfluss haben Sie?
Gutachten, Kostenvoranschlag oder Eigenleistung?
Ob Reparatur durch Handwerker oder Selbstbau: Wie der Schaden bewertet wird, hat direkten Einfluss auf die Auszahlung – und auf Ihre Rechte.
Nach der Schadenmeldung beauftragt der Versicherer in der Regel einen Sachverständigen, der den Schaden vor Ort begutachtet. Ziel ist es, Art, Umfang und Ursache des Schadens fachlich einzuordnen – denn davon hängt ab, wie hoch Ihre Entschädigung ausfällt.
In vielen Fällen fordert der Versicherer zusätzlich einen Kostenvoranschlag – entweder vom beauftragten Handwerker oder als Basis für eine sogenannte fiktive Abrechnung. Dabei wird der Schaden zwar nicht sofort repariert, Sie erhalten aber eine Erstattung auf Grundlage des Gutachtens oder Angebots. Das ist besonders bei kleineren Schäden oder geplanter Eigenleistung eine sinnvolle Option.
Wenn Sie Reparaturen selbst durchführen möchten, kann die Versicherung auch Eigenleistung entschädigen – allerdings nicht mit dem üblichen Handwerkerlohn. Stattdessen wird ein angemessener Pauschalwert angesetzt. Wichtig ist hier die vorherige Abstimmung mit dem Versicherer.
Hinweis: Die Abrechnung erfolgt fast immer auf Grundlage ortsüblicher Preise und Arbeitskosten. Weichen Ihre Angebote stark davon ab, kann das zu Kürzungen führen – oder zu Nachverhandlungen mit dem Gutachter.
Typische Wege der Bewertung
Offizielles Gutachten durch einen Sachverständigen der Versicherung
Kostenvoranschlag eines qualifizierten Handwerksbetriebs
Eigenbewertung mit Fotos + Materialliste bei kleineren Reparaturen
Fiktive Abrechnung möglich – Auszahlung ohne tatsächliche Reparatur
Eigenleistung muss vorab mit der Versicherung abgesprochen sein
Typische Gebäudeschäden – diese Ursachen treten besonders häufig auf
Diese drei Schäden sollten Sie als Hausbesitzer unbedingt kennen
Ein Schaden kann viele Ursachen haben – nicht nur Naturgewalten oder technisches Versagen. Hier finden Sie drei der häufigsten Schadenarten, die in der Wohngebäudeversicherung relevant sind.
Sturm- und Hagelschäden

Starke Sturmböen oder Hagelschauer können Dächer abdecken, Fassaden beschädigen oder Fenster zerstören. Die Wohngebäudeversicherung schützt in der Regel bei Windstärken ab 62 km/h – entscheidend ist die genaue Dokumentation und die Ursache.
Wasserschäden im Gebäude

Ob durch defekte Leitungen, undichte Dächer oder Rückstau – Wasserschäden zählen zu den häufigsten Gebäudeschäden. Wichtig ist, ob die Ursache versichert ist und wie schnell gehandelt wurde.
Einbruchbedingte Gebäudeschäden

Bei einem Einbruch entstehen häufig Schäden am Gebäude – etwa durch aufgebrochene Türen oder Fenster. Solche Einbruchfolgen sind in vielen Wohngebäudeversicherungen mitversichert, wenn entsprechende Nachweise vorliegen.
Welche Form der Erstattung passt zu Ihrem Fall?
Auszahlungsmöglichkeiten im Überblick
Ob Sofortzahlung, Abschlag oder Wiederherstellungswert – bei der Schadenregulierung gibt es mehr als eine Option.
Sobald der Schaden bewertet und anerkannt wurde, geht es um die Auszahlung. Dabei haben Sie als Versicherungsnehmer verschiedene Optionen, die sich je nach Schadenshöhe, Schadenart und geplanter Sanierung unterscheiden.
Eine häufige Form ist die Barwertentschädigung, bei der die Versicherung den aktuellen Zeitwert des beschädigten Gebäudeteils auszahlt – also den Wert nach Abzug der Alters- und Abnutzungseinflüsse. Dies ist vor allem bei älteren Gebäuden oder bei Eigenleistungen relevant.
Alternativ kann die Auszahlung auf Basis der Wiederherstellungskosten erfolgen – also dem Betrag, den eine fachgerechte Reparatur heute kosten würde. In diesem Fall kann auch eine Abschlagszahlung verlangt werden, wenn die vollständige Regulierung noch aussteht.
Besonders praktisch: Viele Versicherungen bieten eine fiktive Abrechnung an. Sie erhalten dann Geld auf Basis eines Gutachtens oder Kostenvoranschlags – auch wenn Sie noch nicht saniert haben. Das gibt Ihnen Flexibilität, verpflichtet Sie aber nicht zur sofortigen Wiederherstellung.
Ihre Optionen im Überblick:
Barwertentschädigung: Auszahlung des aktuellen Werts unter Berücksichtigung der Abnutzung
Wiederherstellungskosten: Auszahlung in voller Höhe nach Sanierung oder Wiederaufbau
Fiktive Abrechnung: Geld auf Basis eines Gutachtens, ohne direkte Reparatur
Teilzahlungen/Abschlagszahlungen: Vorab-Erstattung bei längerer Bearbeitung
Wenn es kompliziert wird: Ihre Rechte und Pflichten im Überblick
Was tun, wenn die Versicherung nicht zahlt?
Nicht jede Schadensmeldung führt automatisch zur Auszahlung. Erfahren Sie, welche Schritte Sie unternehmen können, wenn es zu Problemen bei der Schadensregulierung kommt.
Es kann vorkommen, dass Versicherungen die Schadensregulierung verzögern oder ablehnen. In solchen Fällen ist es wichtig, Ihre Rechte zu kennen und entsprechend zu handeln.
Typische Gründe für Ablehnungen:
Unzureichende Dokumentation des Schadens
Verletzung von Sicherheitsvorschriften
Verdacht auf grobe Fahrlässigkeit
Unklare oder widersprüchliche Angaben
Empfohlene Maßnahmen:
Einholung eines unabhängigen Gutachtens
Einschaltung eines Fachanwalts für Versicherungsrecht
Kontaktaufnahme mit der Verbraucherzentrale
Prüfung der Möglichkeit eines Ombudsmannverfahrens
Durch proaktives Handeln und die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung können Sie Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Schadensregulierung erhöhen.
Weitere häufige Gebäudeschäden – diese Ursachen sollten Sie kennen
Von Rohrbruch bis Naturgefahr – Schäden haben viele Gesichter
Nicht jeder Gebäudeschaden entsteht plötzlich – manche entwickeln sich über Wochen oder Monate. Hier finden Sie weitere typische Schadenarten, die Hausbesitzer betreffen können.

Rohrbruch im Haus
Ein geplatztes Rohr kann in kürzester Zeit große Mengen Wasser freisetzen und Wände, Böden oder Decken durchfeuchten. Die Ursache entscheidet, ob der Schaden versichert ist – und welche Maßnahmen sofort nötig sind.

Undichtes Dach
Ein undichtes Dach kann durch Sturm, Alterung oder bauliche Mängel entstehen. Dringt Wasser ins Gebäude ein, drohen Folgeschäden an Dämmung, Wänden und Decken – schnelles Handeln ist gefragt.
Weitere Themen
Zusammenfassung
Die Auszahlung nach einem Gebäudeschaden hängt nicht nur vom Schaden selbst, sondern auch von Ihrem Vorgehen ab. Wer den Schaden rechtzeitig meldet, sorgfältig dokumentiert und die richtigen Nachweise einreicht, hat beste Chancen auf eine schnelle und faire Entschädigung.
Ob Barwert, Wiederherstellungskosten oder fiktive Abrechnung – die Wohngebäudeversicherung bietet verschiedene Wege zur Regulierung. Wichtig ist, dass Sie Ihre Rechte kennen und sich aktiv in den Prozess einbringen. Bei Unklarheiten oder Ablehnungen stehen Ihnen zudem Gutachter und Anwälte zur Seite. Mit dem passenden Versicherungsschutz und dem richtigen Wissen bleiben Sie auch im Schadensfall handlungsfähig.
häufige Fragen
Kann ich bei der Gebäudeversicherung nach Kostenvoranschlag abrechnen?
Ja, viele Versicherer akzeptieren eine fiktive Abrechnung auf Basis eines Kostenvoranschlags oder Gutachtens – auch wenn keine Reparatur durchgeführt wird. Wichtig: Vorab klären, ob der Versicherer dies zulässt.
Wie lange dauert es von der Schadenmeldung bis zur Auszahlung?
Das hängt vom Einzelfall ab. In der Regel erfolgt die Auszahlung innerhalb weniger Wochen nach vollständiger Einreichung aller Unterlagen und erfolgter Begutachtung. Komplexe Fälle dauern länger.
Wird Eigenleistung bei Reparaturen erstattet?
Teilweise. Bei selbst durchgeführten Reparaturen zahlen manche Versicherer einen Pauschalbetrag als Ausgleich für die Eigenleistung. Voraussetzung ist, dass Sie dies vorab mit dem Versicherer abstimmen.
Was tun, wenn die Versicherung nicht zahlt oder kürzt?
Wenden Sie sich zunächst schriftlich an den Versicherer mit einer Begründung. Bringt das keine Klärung, kann ein privates Gutachten oder anwaltlicher Beistand helfen. In letzter Instanz bleibt der Rechtsweg.

