Typische Schadensfälle in der Wohngebäudeversicherung
Von Leitungswasser bis Vandalismus: Welche Schäden übernimmt die Gebäudeversicherung – und welche nicht?

Sturmschäden, Rohrbrüche oder sogar ein Feuer – Gebäudeschäden kommen meist plötzlich und verursachen schnell hohe Kosten. In solchen Situationen zählt nicht nur der richtige Versicherungsschutz, sondern auch ein klarer Fahrplan, wie Sie im Ernstfall handeln. Als erfahrene Versicherungsmakler unterstützen wir Sie dabei, den Überblick zu behalten und sorgen dafür, dass Sie im Schadenfall rechtzeitig und korrekt reagieren. So sichern Sie sich die bestmögliche Erstattung und vermeiden unnötigen Ärger mit Ihrer Versicherung.
Nutzen Sie die Übersicht, um direkt zu den einzelnen Schäden und den passenden Artikeln zu springen. So finden Sie schnell Antworten auf Ihre Fragen – von typischen Schadensbildern bis zur Auszahlung durch die Gebäudeversicherung.
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
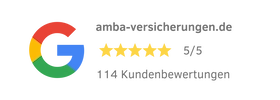
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Gebäudeschutz von A bis Z – das leistet eine Wohngebäudeversicherung
Was ist eine Wohngebäudeversicherung?
Die Wohngebäudeversicherung schützt Immobilienbesitzer vor den finanziellen Folgen unvorhersehbarer Schäden am Haus. Ob Feuer, Sturm, Hagel oder Leitungswasserschäden – die Versicherung übernimmt die Kosten für Reparaturen oder den Wiederaufbau und sorgt so dafür, dass Sie in Krisensituationen nicht allein dastehen. Sie ist eine der wichtigsten Absicherungen für Eigentümer, vor allem bei selbstgenutztem Wohneigentum oder vermieteten Objekten.
In der Wohngebäudeversicherung sind in der Regel folgende Risiken abgedeckt:
Feuerschäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion
Leitungswasserschäden, z. B. durch Rohrbruch oder undichte Verbindungen
Sturm- und Hagelschäden ab Windstärke 8
Folgeschäden, etwa durch Löschwasser, Rauch oder Überspannung
Feste Gebäudebestandteile wie Dach, Fassade, Fenster, Türen, Heizungsanlagen, Einbauküchen und Nebengebäude
Optional können Elementargefahren wie Überschwemmung, Erdbeben oder Schneedruck über eine Elementarschadenversicherung mitversichert werden.
Eine Wohngebäudeversicherung ist für alle Hausbesitzer sinnvoll – unabhängig davon, ob die Immobilie selbst genutzt oder vermietet wird. Besonders wichtig ist sie für:
Eigentümer von Immobilien
Vermieter, die ihre Investition absichern möchten
Finanzierte Immobilien: Banken verlangen in der Regel den Nachweis einer Wohngebäudeversicherung als Voraussetzung für die Kreditvergabe
Selbstständige oder Unternehmer, die ihr Haus versichern
Ohne diese Versicherung tragen Eigentümer das gesamte Risiko selbst – und das kann im Schadenfall schnell existenzbedrohend werden.
Sturm- und Hagelschäden: Wenn das Wetter zur Gefahr fürs Haus wird
Sturm- und Hagelschäden
Sturm oder Hagel können am Dach, an der Fassade oder an Fenstern große Schäden anrichten – oft innerhalb weniger Minuten. Besonders bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h kommt es regelmäßig zu Versicherungsmeldungen. Gut, wenn dann die Wohngebäudeversicherung einspringt.

Sturm- und Hagelschäden zählen zu den häufigsten Fällen in der Wohngebäudeversicherung. Versichert sind Schäden, die durch Wind ab Stärke 8 (ca. 62 km/h) oder Hagelkörner verursacht werden – zum Beispiel:
Abgedeckte Dächer und herausgerissene Dachziegel
Zerschlagene Fenster oder Rollläden
Eingedrückte Fassaden
Wassereintritt durch zerstörte Außenhülle
Voraussetzung für die Leistung: Der Sturm muss eine gewisse Intensität nachgewiesen haben – etwa durch Messdaten des Deutschen Wetterdienstes oder Schäden an Nachbargebäuden.
Wichtig zu wissen: Werden Fenster offengelassen oder lockere Dachziegel nicht gesichert, kann die Versicherung die Leistung kürzen – aufgrund von grober Fahrlässigkeit. Sichern Sie deshalb rechtzeitig Fenster, Türen und lose Bauteile.
Auch Folgeschäden – z. B. Wasserschäden durch ein beschädigtes Dach – sind in der Regel mitversichert. Bei schweren Wetterlagen kann eine schnelle Schadenmeldung über das Online-Portal der Versicherung helfen, die Bearbeitungszeit zu verkürzen.
Rohrbruch: Einer der häufigsten und teuersten Gebäudeschäden
Wenn das Wasser unkontrolliert fließt – was Sie bei einem Rohrbruch beachten müssen
Ein Rohrbruch entsteht oft plötzlich – und hinterlässt binnen Minuten massive Schäden. Ob Decken, Böden oder Wände: Ein geplatztes Wasserrohr kann ein gesamtes Haus lahmlegen. Für Hausbesitzer ist es daher entscheidend, schnell zu reagieren und die Versicherung richtig einzuschalten.

Ein Rohrbruch kann jeden Hausbesitzer unerwartet treffen – oft geschieht es nachts oder bei Abwesenheit. Innerhalb kürzester Zeit treten große Mengen Wasser aus, die Decken, Böden und Wände beschädigen. Der Schaden geht meist weit über die defekte Leitung hinaus. In solchen Fällen hilft die Wohngebäudeversicherung, den finanziellen Aufwand zu begrenzen – vorausgesetzt, es handelt sich um einen versicherten Leitungswasserschaden.
Typischerweise sind folgende Rohrsysteme mitversichert:
fest installierte Wasserleitungen für Heizung und Trinkwasser
Abwasserrohre innerhalb des Gebäudes
Zu- und Ableitungen von Heizungsanlagen, Wärmepumpen und Boilern
Doch ein Rohrbruch verursacht nicht nur technische Schäden – er kann das gesamte Wohnumfeld beeinträchtigen. Wasserdurchtränkte Bauteile müssen getrocknet, Schimmel entfernt und beschädigte Bausubstanz saniert werden. Auch eine vorübergehende Unbewohnbarkeit der Immobilie ist möglich.
Die Wohngebäudeversicherung übernimmt in der Regel:
Ortung und Freilegung des Rohrschadens
Reparatur der betroffenen Leitung
Wiederherstellung von Wänden, Böden und Decken
Kosten für Bautrocknung und Hotelunterbringung, falls notwendig
Nicht alle Wasserschäden gelten als Rohrbruch im Sinne der Versicherung. Schäden durch defekte Dichtungen, undichte Armaturen oder falsch angeschlossene Geräte sind meist nicht gedeckt und können zu Streitfällen führen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Versicherung ist daher immer sinnvoll.
Marderschäden: Kleine Tiere, großer Ärger fürs Dach
Was die Wohngebäudeversicherung bei Marderschäden zahlt – und was nicht
Ein Marder auf dem Dachboden bleibt oft lange unbemerkt. Doch während er nachts aktiv ist, verursacht er Schäden an Dämmmaterialien, Kabeln oder sogar an der Dacheindeckung. Für Hausbesitzer kann das teuer werden – vor allem, wenn sich der Schaden über Monate entwickelt hat. Eine Wohngebäudeversicherung kann helfen, doch längst nicht alle Kosten sind automatisch gedeckt.

Marder gelangen oft über das Dach oder die Regenrinne ins Haus. Besonders gefährdet sind Dächer mit Zugang über Bäume oder ungeschützte Öffnungen. Im Inneren nisten sie sich zwischen Dämmstoffen ein, zerbeißen Kabel und sorgen mit ihren Hinterlassenschaften für hygienische Probleme. Die Geräuschbelästigung ist das geringste Problem – viel teurer wird es, wenn der Schaden an der Substanz erkannt wird.
Viele Gebäudeversicherungen schließen Tierbissschäden nur ein, wenn dieser Baustein explizit vereinbart wurde. Dann sind in der Regel folgende Leistungen abgesichert:
Reparatur beschädigter Dämmungen oder Dachbauteile
Austausch von zerbissenen Kabeln und Leitungen
Beseitigung von Verschmutzungen durch den Marderbefall
Abdichtung von Einstiegsmöglichkeiten am Dach
Ob eine Erstattung erfolgt, hängt oft davon ab, wie der Schaden gemeldet und dokumentiert wird. Spätschäden, etwa durch Feuchtigkeit oder Folgeschäden an der Elektrik, werden ohne eindeutigen Zusammenhang zum Marder nicht immer anerkannt.
Nicht versichert sind in vielen Tarifen:
Schäden an beweglichen Gegenständen (z. B. Hausrat, Auto)
Folgeschäden ohne nachweisbaren Marderbefall
Kosten für Marderfang oder präventive Maßnahmen (z. B. Ultraschallgeräte)
Im Zweifel lohnt sich ein Blick in die Versicherungsbedingungen – oder ein Beratungsgespräch, bevor es teuer wird.
Schimmel im Haus: Gesundheitsrisiko und teurer Bauschaden
Wann Ihre Wohngebäudeversicherung für Schimmelschäden aufkommt
Schimmel in Wohnräumen ist nicht nur unschön, sondern auch gefährlich für die Gesundheit. Wird er zu spät entdeckt, kann er sich großflächig in Wänden, Decken und Böden ausbreiten. Doch nicht jeder Schimmelbefall ist ein Fall für die Gebäudeversicherung – entscheidend ist die Ursache. Wir zeigen, wann die Versicherung zahlt und worauf Sie achten müssen.

Schimmel entsteht immer dann, wenn Feuchtigkeit dauerhaft nicht entweichen kann. Typische Ursachen sind unerkannte Wasserschäden, undichte Dächer oder Rohrbrüche – aber auch Wärmebrücken oder falsches Lüftungsverhalten. Die Wohngebäudeversicherung greift nur dann, wenn ein versicherter Schaden die Ursache für den Schimmel ist.
In solchen Fällen besteht in der Regel Versicherungsschutz:
Schimmelbildung nach Rohrbruch oder Leitungswasserschaden
Feuchtigkeitsschäden nach einem Sturm mit Dachleck
Schimmel durch Wassereintritt nach Elementarschaden (z. B. Überschwemmung)
Nachfolgeschäden durch nicht erkannte Undichtigkeiten in Dach oder Mauerwerk
Kommt der Schimmel dagegen durch bauliche Mängel oder falsches Heizen und Lüften zustande, lehnen viele Versicherer die Leistung ab. Auch kleinere Flecken ohne direkten Zusammenhang zu einem versicherten Schaden sind meist nicht gedeckt.
Nicht versichert sind in der Regel:
Schimmel durch falsches Lüften oder Kondenswasser
Befall infolge unterlassener Instandhaltung
Schäden an Möbeln oder Hausrat – dafür ist die Hausratversicherung zuständig
Gesundheitsfolgen oder medizinische Maßnahmen
Wichtig ist eine schnelle Ursachenklärung und eine fachgerechte Dokumentation. Nur so lässt sich im Zweifel der Leistungsanspruch gegenüber der Versicherung durchsetzen.
Einbruch: Wenn das Zuhause zum Tatort wird
Was Ihre Wohngebäudeversicherung nach einem Einbruch übernimmt – und was nicht
Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Eigentümer ein Schock – nicht nur wegen des materiellen Schadens, sondern auch wegen des Gefühls, dass die eigene Sicherheit verletzt wurde. Neben gestohlenen Gegenständen hinterlassen Täter oft Schäden an Fenstern, Türen oder sogar an der Fassade. In bestimmten Fällen greift hier die Wohngebäudeversicherung.

Nach einem Einbruch ist nicht nur der Hausrat betroffen – auch am Gebäude entstehen oft sichtbare Spuren. Eingeschlagene Fensterscheiben, aufgebrochene Türrahmen oder beschädigte Rolläden fallen unter die Zuständigkeit der Wohngebäudeversicherung, sofern das Objekt fest mit dem Gebäude verbunden ist.
In der Regel übernimmt die Versicherung folgende Leistungen:
Reparatur oder Ersatz zerstörter Fenster, Türen und Schlösser
Wiederherstellung beschädigter Fassaden- oder Wandbereiche
Sofortmaßnahmen zur Sicherung des Gebäudes (z. B. Notverglasung)
Kostenübernahme für Einbruchspuren an Einbauküchen oder fest verbauten Möbeln
Nicht ersetzt werden gestohlene Gegenstände – diese sind über die Hausratversicherung abgesichert. Auch emotionale Belastungen oder der Austausch von beweglichem Inventar (z. B. Lampen, Dekoartikel) fallen nicht unter die Gebäudeversicherung.
Nicht versichert sind:
Schäden an beweglichem Hausrat (Hausratversicherung notwendig)
Schäden bei grob fahrlässigem Verhalten (z. B. offenstehende Türen)
Schäden durch Vandalismus ohne Einbruch (nur mit Zusatzbaustein abgesichert)
Reinigungskosten oder psychologische Betreuung nach dem Ereignis
Die wichtigste Maßnahme nach einem Einbruch ist eine schnelle Polizei- und Schadensmeldung. Dokumentieren Sie alle baulichen Schäden umfassend und sichern Sie Beweise für die spätere Regulierung mit dem Versicherer.
Wasserschaden im Haus: Unterschätzt und oft langwierig
Wie die Wohngebäudeversicherung bei Wasserschäden greift – und was sie nicht abdeckt
Ein Wasserschaden gehört zu den häufigsten Gründen für eine Schadensmeldung bei der Gebäudeversicherung – und ist gleichzeitig einer der kompliziertesten. Denn Wasser sucht sich seinen Weg, oft unbemerkt über Wochen oder sogar Monate. Die Folge: durchnässte Wände, beschädigte Böden und im schlimmsten Fall Schimmelbildung. Wann genau die Versicherung zahlt, hängt von der Ursache ab.

Nicht jeder Wasserschaden ist automatisch ein Fall für die Wohngebäudeversicherung. Entscheidend ist, ob das Wasser aus einem versicherten Leitungssystem stammt oder durch ein versichertes Ereignis – etwa einen Sturm oder eine geplatzte Leitung – ins Gebäude eingedrungen ist. Besonders bei verdeckten Schäden sind eine frühzeitige Entdeckung und sorgfältige Dokumentation wichtig.
Typisch versicherte Ursachen sind:
Rohrbrüche an fest verlegten Leitungen
geplatzte Heizungs- oder Trinkwasserrohre
Nässeschäden infolge von Sturmschäden oder Dachundichtigkeiten
Wasseraustritt aus fest installierten Warmwasserbereitern
Viele Wasserschäden entwickeln sich schleichend. Wird ein Leck erst spät erkannt, können Trocknung, Sanierung und die Beseitigung von Schimmel sehr kostspielig werden. Ist jedoch der Versicherungsfall klar nachweisbar, übernimmt die Gebäudeversicherung in der Regel die notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung.
Nicht versichert sind unter anderem:
Schäden durch Grundwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit
Wasseraustritt durch defekte Waschmaschinen oder Spülmaschinen (Hausratversicherung)
Wasserschäden bei unsachgemäßer Installation oder Fahrlässigkeit
Schäden an beweglichem Inventar – dafür ist die Hausratversicherung zuständig
Achten Sie nach einem Wasserschaden unbedingt darauf, die Ursache professionell feststellen zu lassen und das weitere Vorgehen mit dem Versicherer abzustimmen. Nur so lassen sich Probleme bei der Regulierung vermeiden.
Undichtes Dach: Wenn’s von oben tropft, wird’s teuer
Wann Ihre Wohngebäudeversicherung bei einem undichten Dach leistet
Ein undichtes Dach ist mehr als nur ein bauliches Ärgernis – es kann schnell zu massiven Wasserschäden führen. Dringt Feuchtigkeit über das Dach ins Gebäude ein, sind oft nicht nur die Dachkonstruktion, sondern auch Decken, Wände und Dämmmaterial betroffen. Ob die Wohngebäudeversicherung den Schaden übernimmt, hängt von der Ursache ab.

Ein undichtes Dach entsteht oft durch Sturmschäden, beschädigte Ziegel, marode Dachabdichtungen oder verstopfte Dachrinnen. Sobald Feuchtigkeit eindringt, muss schnell gehandelt werden, um Folgeschäden zu begrenzen. Ist das Leck jedoch auf mangelnde Wartung oder Alterung zurückzuführen, verweigert die Versicherung häufig die Leistung.
Die Wohngebäudeversicherung greift in folgenden Fällen:
Schäden durch Sturm, Hagel oder herabfallende Äste
Wassereintritt nach einem versicherten Naturereignis
Folge- und Nässeschäden an Mauerwerk, Decken oder Dämmung
Notmaßnahmen zur Abdichtung des Daches (z. B. Abdeckung durch Fachfirma)
Die Ursache ist entscheidend: Besteht der Schaden aufgrund unterlassener Instandhaltung, schlechter Bauausführung oder altersbedingter Abnutzung, lehnt die Versicherung häufig die Regulierung ab. Auch sogenannte „langsame Durchfeuchtungen“, die nicht auf ein plötzliches Ereignis zurückzuführen sind, sind oft ausgeschlossen.
Nicht versichert sind meist:
Undichtigkeiten durch poröse Dichtstoffe oder altersbedingte Risse
Schäden durch verstopfte Fallrohre ohne Sturmfolge
Reparaturen, die aus allgemeinem Sanierungsbedarf resultieren
Schimmelbildung durch über längere Zeit unbemerkte Lecks
Eine regelmäßige Kontrolle des Daches, besonders nach Stürmen, sowie die fachgerechte Wartung durch Dachdeckerbetriebe sind wichtige Maßnahmen zur Schadenvermeidung – und stärken Ihre Position im Schadensfall.
Umgestürzter Baum: Wenn Naturgewalten zum Risiko für Ihr Haus werden
Wann Ihre Wohngebäudeversicherung für Sturmschäden durch Bäume aufkommt
Ein umgestürzter Baum kann schwere Schäden am Haus, Dach oder Nebengebäuden verursachen – vor allem bei Sturm oder durchtränktem Boden. Für Hauseigentümer stellt sich dann die Frage: Wer zahlt den Schaden? Die Wohngebäudeversicherung kommt in vielen Fällen für die Reparaturkosten auf – vorausgesetzt, bestimmte Voraussetzungen sind erfüllt.

Bäume stürzen meist infolge starker Stürme, Schneelast oder durchnässter Böden um. Wenn dabei das Gebäude, eine Garage, ein Wintergarten oder feste Bestandteile des Grundstücks beschädigt werden, kann die Wohngebäudeversicherung einspringen – allerdings nur bei versicherten Naturereignissen wie Sturm oder Hagel.
Folgende Leistungen sind typischerweise abgedeckt:
Reparaturkosten bei Beschädigung von Dach, Fassade oder Nebengebäuden
Beseitigung des Baumes, sofern er versicherte Gebäudeteile beschädigt hat
Kosten für Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Bausubstanz
Entsorgung von Trümmern, sofern Teil der vereinbarten Leistung
Wichtig ist, dass der Baum infolge eines versicherten Ereignisses umgestürzt ist – also etwa durch einen Sturm ab Windstärke 8. Ist der Baum jedoch krank, morsch oder schlecht gepflegt, kann die Versicherung ihre Leistung verweigern. Auch Sturzschäden auf unbewegliches Inventar (z. B. Gartenmöbel) sind nicht über die Wohngebäudeversicherung gedeckt.
Nicht versichert sind:
Schäden an mobilen Objekten wie Zäunen, Pavillons oder Pools
Umgestürzte Bäume ohne Gebäudeschaden
Fäll- und Entsorgungskosten bei bloßer Gefahrenabwehr
Schäden durch unzureichende Pflege oder Baumkrankheiten
Im Schadensfall empfiehlt es sich, den Baum nicht eigenständig zu beseitigen, sondern zunächst zu dokumentieren und ggf. durch den Versicherer begutachten zu lassen.
Vandalismus: Vorsätzliche Schäden am Haus – und wer sie bezahlt
Wie die Wohngebäudeversicherung bei mutwilliger Zerstörung greift
Zerkratzte Türen, eingeschlagene Fenster oder zerstörte Briefkästen – Vandalismus richtet oft nicht nur optische, sondern auch finanzielle Schäden an. Gerade bei leerstehenden oder vermieteten Gebäuden sind solche Vorfälle keine Seltenheit. Doch wann genau leistet die Wohngebäudeversicherung – und wann ist zusätzlicher Schutz notwendig?

Vandalismusschäden am Gebäude sind in der klassischen Wohngebäudeversicherung nicht automatisch enthalten. Nur wenn der Schaden im Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl steht – also z. B. eine Tür bei einem Einbruch zerstört wurde – greift der Schutz in vielen Standardtarifen.
Für alle anderen Fälle vorsätzlicher Beschädigung (z. B. mutwilliges Zerkratzen, Bemalen, Zerstören) ist ein zusätzlicher Vandalismusbaustein erforderlich. Dieser wird vor allem bei vermieteten oder leerstehenden Immobilien empfohlen.
Typisch versicherte Schäden bei passender Erweiterung:
Eingeschlagene Fenster und Türen ohne Einbruch
Bemalung oder Beklebung der Fassade (z. B. Graffiti)
Mutwillig beschädigte Gebäudeteile (Briefkästen, Gegensprechanlagen etc.)
Zerstörung von Zäunen, Mauerwerk oder festen Außenanlagen
Ohne Erweiterung trägt der Eigentümer die Kosten meist selbst. Auch die Beweispflicht liegt beim Versicherungsnehmer – es muss klar erkennbar sein, dass es sich um vorsätzliche Beschädigung handelt und kein Versehen oder Unfall vorliegt.
Nicht versichert sind in der Regel:
Schäden durch unklare Verursachung ohne Vandalismusnachweis
Schäden an beweglichem Eigentum (Hausratversicherung nötig)
Reinigungs- oder Wiederherstellungskosten ohne Beschädigung
Vandalismus in leerstehenden Gebäuden ohne Zusatzdeckung
Wer sein Objekt regelmäßig kontrollieren lässt und die Zusatzbausteine richtig auswählt, kann im Ernstfall viel Geld sparen – vor allem bei vermieteten oder schwer einsehbaren Immobilien.
Naturgefahren: Wenn Wetterextreme zur realen Bedrohung werden
Wie die Wohngebäudeversicherung bei Naturgefahren schützt – und wann die Elementarversicherung greifen muss
Extreme Wetterereignisse wie Überschwemmung, Starkregen oder Erdrutsch treten in Deutschland immer häufiger auf – mit teils dramatischen Folgen für Hausbesitzer. Die Wohngebäudeversicherung bietet hier nur begrenzten Schutz. Für umfassende Sicherheit ist der Abschluss einer erweiterten Elementarschadenversicherung unverzichtbar.

Viele Naturereignisse sind nicht automatisch in der klassischen Wohngebäudeversicherung enthalten. Sie greift in der Regel nur bei Schäden durch Sturm und Hagel. Für alle weiteren Naturgefahren benötigen Sie einen zusätzlichen Elementarschutz. Dieser kann als Baustein zur Wohngebäudeversicherung abgeschlossen werden – und wird in vielen Risikogebieten inzwischen sogar dringend empfohlen.
Mitversichert durch den Baustein Elementar sind z. B.:
Überschwemmung durch Starkregen oder Hochwasser
Rückstau in der Kanalisation infolge starker Regenfälle
Erdrutsch, Erdsenkung oder Schneedruck
Lawinen, Vulkanausbrüche (selten, aber in der Deckung enthalten)
Ein vollständiger Schutz besteht nur, wenn auch dieser Zusatzbaustein aktiv abgeschlossen wurde. Ohne ihn müssen Eigentümer die Kosten oft vollständig selbst tragen – selbst wenn das Haus unbewohnbar wird. Gerade in Hochwasser- oder Starkregenregionen ist der Versicherungsschutz ohne Elementarversicherung deutlich eingeschränkt.
Nicht versichert ohne Elementarbaustein sind:
Schäden durch eindringendes Wasser bei Starkregen
Kellerüberflutungen bei Rückstau aus der Kanalisation
Schäden durch Erdbewegungen oder Bodensenkungen
Gebäudeschäden durch Schneedruck oder Lawinen
Achten Sie bei Abschluss unbedingt auf die genauen Bedingungen – insbesondere bei der Definition von Überschwemmung oder Rückstau. Auch die Höhe der Selbstbeteiligung und mögliche Wartezeiten sollten Sie prüfen.

Was tun im Schadensfall
Wenn es zu einem Gebäudeschaden kommt, zählt jede Minute. Je schneller und gezielter Sie reagieren, desto reibungsloser läuft die Regulierung mit Ihrer Wohngebäudeversicherung. Dabei kommt es nicht nur auf gute Dokumentation an, sondern auch auf die richtigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
Schadensbegrenzung und Sofortmaßnahmen
Sichern Sie gefährdete Bereiche ab und verhindern Sie Folgeschäden – zum Beispiel durch Abdichten eines Dachs oder Absperren der Umgebung. Bei Gefahr immer zuerst Polizei oder Feuerwehr verständigen.
Schaden dokumentieren und festhalten
Fotografieren oder filmen Sie alle Schäden detailliert. Sammeln Sie relevante Belege, Gutachten und – wenn vorhanden – Zeugenaussagen. Jede Information hilft der Versicherung bei der Einschätzung.
Schaden schnellstmöglich melden
Informieren Sie Ihre Versicherung ohne Verzögerung – idealerweise digital über das Kundenportal oder telefonisch. Melden Sie den Schaden mit allen Unterlagen vollständig, um Rückfragen zu vermeiden.
Zusammenfassung
Sturm, Leitungswasser, Marder oder Naturgewalten – Gebäudeschäden können viele Gesichter haben und treffen Eigentümer oft unvorbereitet. Wer im Ernstfall gut abgesichert sein möchte, sollte nicht nur auf den richtigen Versicherungsschutz achten, sondern auch wissen, wie man sich im Schadensfall richtig verhält. Unsere Übersicht zeigt, welche Schäden häufig auftreten, wie sie reguliert werden und worauf es bei der Schadensmeldung ankommt. Mit der passenden Wohngebäudeversicherung – idealerweise ergänzt um eine Elementarschadenversicherung – schützen Sie nicht nur Ihr Haus, sondern auch sich selbst vor unkalkulierbaren Kosten. Als Versicherungsmakler beraten wir Sie gerne persönlich und unabhängig, damit Sie im Fall der Fälle bestmöglich aufgestellt sind.
häufige Fragen
Welche Schäden übernimmt die Gebäudeversicherung?
Die Wohngebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel ab. Auch Folgeschäden durch Löschwasser oder Nässeschäden nach einem Sturm sind meist versichert. Schäden durch Naturgefahren wie Überschwemmung oder Erdrutsch sind nur mit einer Elementarschadenversicherung abgedeckt.
Was tun, wenn ein Schaden am Haus entsteht?
Zuerst die Schadensursache eindämmen, falls nötig Polizei oder Feuerwehr rufen. Danach den Schaden dokumentieren (Fotos, Videos) und schnellstmöglich dem Versicherer melden. Änderungen an der Schadenstelle sollten vorher mit dem Versicherer abgestimmt werden.
Wann zahlt die Gebäudeversicherung nicht?
Nicht gezahlt wird bei grober Fahrlässigkeit (z. B. offengelassene Fenster bei Sturm), bei Schäden durch nicht versicherte Ursachen (z. B. aufsteigende Feuchtigkeit) oder bei unterlassener Instandhaltung. Auch schleichende Schäden ohne klaren Auslöser sind häufig ausgeschlossen.
Wie lange dauert es, bis ein Schaden reguliert wird?
Die Bearbeitungsdauer hängt vom Einzelfall ab. Kleine Schäden werden oft innerhalb weniger Tage geregelt. Bei größeren Fällen mit Gutachtereinsatz oder Nachweispflicht kann es mehrere Wochen dauern. Eine vollständige und schnelle Dokumentation beschleunigt den Prozess erheblich.

