Abzüge bei Berufsunfähigkeit – so viel bleibt von der BU-Rente tatsächlich übrig
Steuern, Krankenversicherung und Anrechnung – wir zeigen, welche Abzüge bei einer BU-Rente berücksichtigt werden müssen
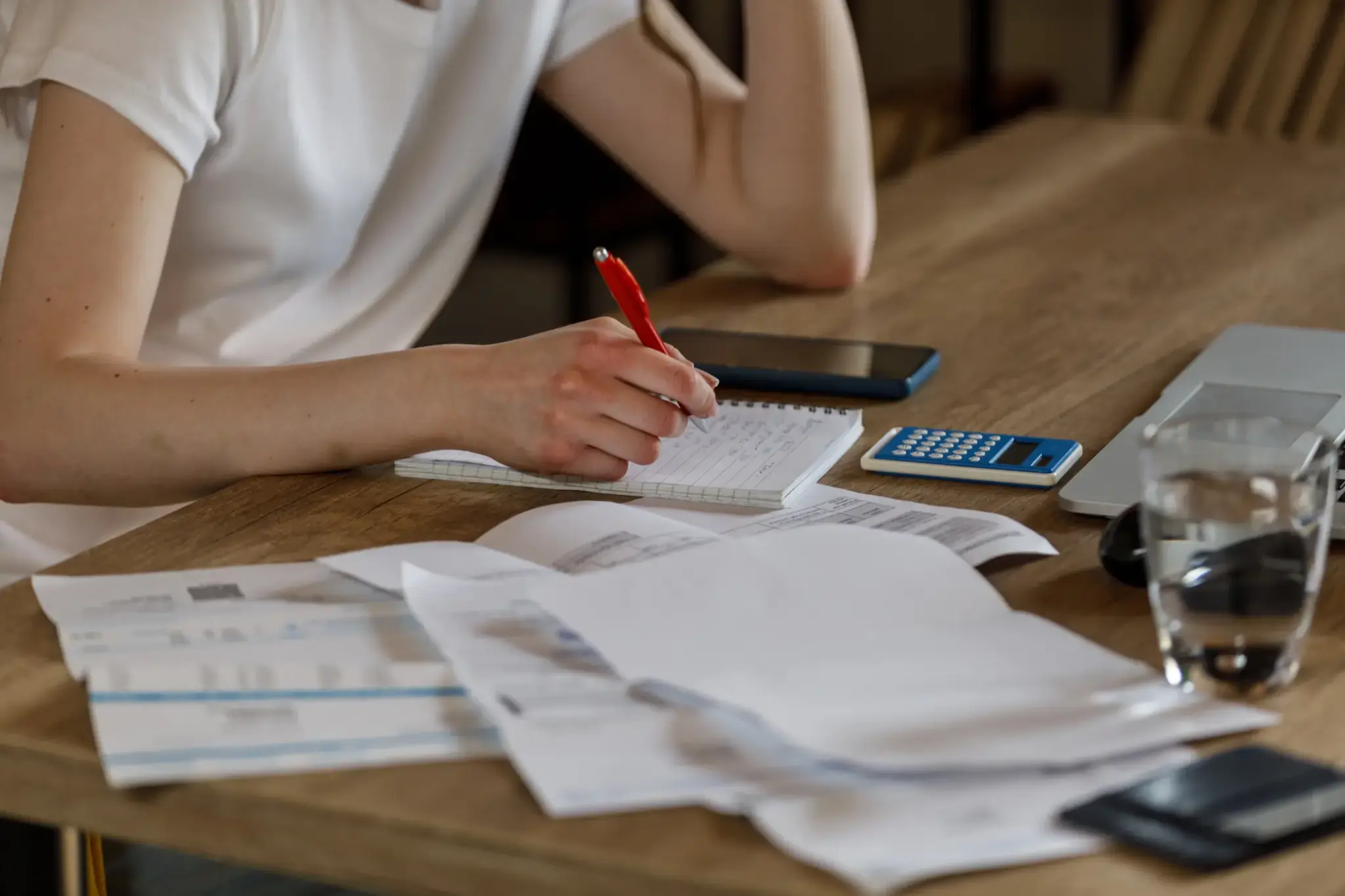
Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, denkt oft in Bruttobeträgen. Doch was nach Steuern und Sozialabgaben tatsächlich auf dem Konto landet, ist meist deutlich weniger. Die Höhe der Abzüge hängt von verschiedenen Faktoren ab – etwa der Versicherungsart, der Kombination mit anderen Vorsorgeprodukten oder dem Krankenversicherungsstatus. Ob gesetzlich oder privat versichert, ob selbstständige BU oder Zusatzbaustein: Für jede Konstellation gelten andere Regeln. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, welche Abzüge bei einer Berufsunfähigkeitsrente realistisch sind, wie Sie die steuerliche Belastung einordnen können – und welche Gestaltungsspielräume Ihnen bleiben.
Das Wichtigste auf einem Blick
Über 700 zufriedene Kunden vertrauen uns
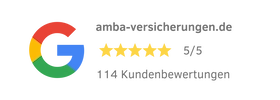
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Wie stark wirkt sich die Besteuerung auf Ihre BU-Rente aus?
Steuerliche Abzüge bei der Berufsunfähigkeitsrente: So viel bleibt nach dem Ertragsanteil
Die steuerliche Behandlung der BU-Rente hängt maßgeblich von der Versicherungsart und der steuerlichen Einordnung ab. Während selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherungen steuerlich begünstigt sind, führen geförderte Modelle wie Rürup oder betriebliche Altersvorsorge zu deutlich höheren Steuerabzügen im Leistungsfall. Entscheidend ist der sogenannte Ertragsanteil – und dieser richtet sich nach dem Alter beim Rentenbeginn.
Bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung erfolgt die Besteuerung grundsätzlich nach dem Ertragsanteilsprinzip – vorausgesetzt, es handelt sich um eine selbstständige BU-Versicherung der 3. Schicht. Hier wird nur ein Teil der monatlichen BU-Rente versteuert, je nachdem, wie alt die versicherte Person beim Eintritt der Berufsunfähigkeit ist. Maßgeblich ist dabei die Restlaufzeit der Rentenzahlung.
Beispiel: Wer mit 40 berufsunfähig wird und eine BU-Rente bis zum 67. Lebensjahr erhält, hat eine Laufzeit von 27 Jahren – der steuerpflichtige Anteil beträgt laut § 22 EStG dann 27 %.
Bei geförderten BU-Modellen (z. B. BUZ in Kombination mit Rürup oder betrieblicher Altersvorsorge) ist die Situation anders. Diese Verträge gehören zur Schicht 1 oder 2 und unterliegen daher einer deutlich strengeren Besteuerung. Während der Beitragsphase gibt es zwar Steuervorteile – im Leistungsfall jedoch wird die BU-Rente entweder vollständig oder zu einem sehr hohen Anteil besteuert. Im Jahr 2025 beträgt der steuerpflichtige Anteil bei einer Rürup-Kombination 85 %, bei bAV sogar 100 %.
Ob und in welchem Umfang Steuern tatsächlich anfallen, hängt aber auch vom persönlichen Einkommen und dem Grundfreibetrag ab. Dieser liegt 2025 bei 12.096 € für Alleinstehende. Bleibt die steuerpflichtige BU-Rente unterhalb dieses Betrags, fällt keine Steuer an.
| Alter bei Rentenbeginn | Laufzeit der BU-Rente | Ertragsanteil (steuerpflichtig) |
|---|---|---|
| 30 Jahre | 37 Jahre | 24 % |
| 40 Jahre | 27 Jahre | 27 % |
| 50 Jahre | 17 Jahre | 32 % |
| 60 Jahre | 7 Jahre | 45 % |
Hinweis: Nur relevant bei selbstständigen BU-Versicherungen der dritten Schicht.
BU-Rente und Krankenversicherung: Wer zahlt was?
Sozialabgaben auf die Berufsunfähigkeitsrente: Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung
Neben der Besteuerung beeinflusst auch der Krankenversicherungsstatus die Höhe der tatsächlichen BU-Rente. Gesetzlich Versicherte zahlen in vielen Fällen Pflichtbeiträge auf ihre Rentenleistung – privat Versicherte müssen ihre Beiträge in voller Höhe selbst weitertragen. Die Abzüge unterscheiden sich deutlich und sollten bei der Netto-Planung unbedingt berücksichtigt werden.
Ob und in welchem Umfang auf eine Berufsunfähigkeitsrente Sozialabgaben fällig werden, hängt entscheidend davon ab, ob Sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Die finanzielle Belastung kann je nach Modell erheblich variieren – gerade bei lang andauernder Berufsunfähigkeit ist das relevant für die Lebensplanung.
Gesetzlich Versicherte (GKV)

Beziehen gesetzlich versicherte Personen eine BU-Rente, werden grundsätzlich Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig – und zwar auch dann, wenn die BU-Rente privat abgeschlossen wurde. Der Hintergrund: Die BU-Rente zählt als sogenannte sonstige Einnahme zur Bestreitung des Lebensunterhalts und unterliegt damit der Beitragspflicht.
Ein gängiger Rechenansatz ist die Faustformel: BU-Rente × 0,82. Diese beinhaltet den allgemeinen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (inkl. Zusatzbeitrag) sowie die Pflegeversicherung. Wer beispielsweise eine monatliche BU-Rente von 2.000 € bezieht, muss rund 1640 € als Berechnungsbasis für die Beitragspflicht ansetzen – was in etwa 300–350 € Abzüge pro Monat bedeuten kann.
Freiwillig gesetzlich Versicherte zahlen unter Umständen sogar Beiträge auf weitere Einkünfte – auch das Einkommen des Ehepartners kann dabei eine Rolle spielen.
Privat Versicherte (PKV)

Anders stellt sich die Situation für privat Krankenversicherte dar: Sie zahlen ihre Beiträge grundsätzlich in voller Höhe weiter, auch wenn sie berufsunfähig sind. Zwar entfällt im Leistungsfall der Anspruch auf Krankentagegeld, der Beitrag zur Krankenversicherung bleibt jedoch stabil – und kann damit schnell mehrere Hundert Euro im Monat betragen. Es gibt keine automatische Reduzierung des Beitrags durch die BU-Rente, da diese nicht in die PKV-internen Bemessungsgrundlagen fällt.
Für privat Versicherte ist es daher besonders wichtig, schon beim Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherung die laufenden PKV-Kosten in der Rentenphase mit einzuplanen. Je nach Anbieter kann eine Beitragsentlastungskomponente sinnvoll sein – eine gezielte Beratung ist hier entscheidend.
Während gesetzlich Versicherte mit prozentualen Abzügen auf ihre BU-Rente rechnen müssen, tragen privat Versicherte die vollen Kosten ihrer Krankenversicherung weiter. In beiden Fällen wirkt sich der Krankenversicherungsstatus erheblich auf die Höhe der Netto-BU-Rente aus – und damit auf die finanzielle Stabilität im Ernstfall.
Was bedeutet die Kombination mit Altersvorsorge für Ihre Steuerlast?
BU-Rente in Kombination mit Rürup oder betrieblicher Altersvorsorge: Steuerliche und soziale Auswirkungen im Vergleich
Wird eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer geförderten Altersvorsorge kombiniert – etwa mit der Rürup-Rente oder der betrieblichen Altersversorgung (bAV) – verändern sich die steuerlichen Spielregeln deutlich. Was in der Ansparphase durch Steuerersparnisse attraktiv wirkt, kann in der Auszahlungsphase zu einer erhöhten Abgabenbelastung führen.
Berufsunfähigkeitsversicherungen können nicht nur eigenständig abgeschlossen werden, sondern auch als Zusatzbaustein im Rahmen geförderter Altersvorsorgeprodukte wie der Rürup-Rente (Basisrente) oder der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Diese Kombinationen bringen steuerliche Vorteile in der Einzahlungsphase – gleichzeitig entstehen jedoch erhebliche Abzüge im Leistungsfall, sobald die BU-Rente gezahlt wird.
BUZ mit Rürup-Rente (Schicht 1)
Bei einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ), die mit einer Rürup-Rente kombiniert wurde, gelten für die Auszahlungsphase dieselben steuerlichen Regelungen wie für die Rente selbst. Das bedeutet:
Im Jahr 2025 sind 85 % der Rentenleistung steuerpflichtig.
Dieser Anteil steigt jährlich, bis im Jahr 2040 eine 100 %ige Besteuerung erreicht wird.
Auch die BU-Rente aus diesem Vertrag wird entsprechend versteuert – unabhängig vom tatsächlichen Bedarf oder der Lebenslage des Versicherten.
Für viele Selbstständige ist diese Kombination attraktiv, da die Beiträge zur BUZ in der Rürup-Rente bis zu 26.528 € jährlich (Stand 2025) steuerlich geltend gemacht werden können. Der steuerliche Vorteil in der Beitragsphase wird aber durch eine stärkere Besteuerung in der Leistungsphase relativiert.
BUZ mit betrieblicher Altersvorsorge (Schicht 2)
Wird die BU-Versicherung über den Arbeitgeber als Teil der bAV abgeschlossen, erfolgt die Beitragszahlung meist aus dem Bruttolohn. Der Vorteil: Das zu versteuernde Einkommen reduziert sich sofort, und auch Sozialversicherungsbeiträge können gespart werden.
Doch im Leistungsfall gilt:
100 % der BU-Rente sind steuerpflichtig.
Es fallen zusätzlich Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an (GKV-Pflichtversicherte).
Die BU-Rente wird wie jede andere Betriebsrente behandelt – ohne Ertragsanteil, ohne Freibeträge.
Dieser Abrechnungsmodus führt dazu, dass insbesondere bei höheren Rentenzahlungen eine spürbare Netto-Kürzung eintritt. Wer seine Absicherung über die bAV organisiert, sollte sich dieser Belastung bewusst sein.
Fazit:
Kombinationen mit Rürup oder bAV bringen steuerliche Vorteile in der Einzahlungsphase – doch diese erkauft man sich mit höheren Steuer- und Sozialabgaben im Leistungsfall. Wer plant, seine Berufsunfähigkeit über solche Modelle abzusichern, sollte frühzeitig kalkulieren, wie viel Netto von der zugesagten Rente bleibt. Eine individuelle Beratung ist dabei unverzichtbar.
Weitere Themen zur finanziellen Planung bei Berufsunfähigkeit
Diese Beiträge helfen Ihnen, die richtige Entscheidung zur BU-Rente zu treffen
Die Frage, wie viel von der BU-Rente nach Steuern und Abgaben übrig bleibt, steht selten isoliert. Wer sich umfassend informieren möchte, sollte auch andere Themenbereiche einbeziehen – etwa die Kosten, die passende Kombination mit Altersvorsorge oder den richtigen Weg bei Vorerkrankungen. Die folgenden Beiträge bieten Ihnen gezielte Unterstützung bei der Planung.
Kosten Berufsunfähigkeitsversicherung

Beitragshöhe, Leistungsdauer, versicherte Rente: Wir erklären, welche Faktoren den Preis Ihrer BU beeinflussen und wie Sie die Balance zwischen Schutz und Beitrag finden.
Anonyme Risikovoranfrage

Sie haben gesundheitliche Vorbelastungen? Mit einer anonymen Anfrage vermeiden Sie Ablehnungen und riskante Eintragungen bei der BU-Antragstellung.
Berufsunfähigkeitsversicherung mit Altersvorsorge

Wer seine BU mit einer Altersvorsorge koppelt, profitiert von Steuervorteilen – muss aber im Leistungsfall mit höheren Abzügen rechnen. Wir zeigen, wann sich welche Kombination lohnt.
Wie die BU-Rente auf Sozialleistungen angerechnet wird
Berufsunfähigkeitsrente und Grundsicherung: Freibeträge, Kürzungen und Einfluss auf staatliche Leistungen
Wird eine private BU-Rente bezogen und gleichzeitig Grundsicherung beantragt, wird die BU-Leistung als Einkommen berücksichtigt. Je nach Höhe kann dies dazu führen, dass staatliche Leistungen gekürzt oder ganz gestrichen werden. Freibeträge bieten einen gewissen Schutz – sind aber begrenzt.
Bei Bezug der Berufsunfähigkeitsrente stellt sich für viele die Frage, wie diese Leistung auf mögliche Sozialleistungen wie die Grundsicherung angerechnet wird. Die rechtliche Grundlage ist eindeutig: Private BU-Renten gelten als Einkommen im Sinne des Sozialrechts und werden bei der Berechnung der Grundsicherung berücksichtigt. Die Folge: Sinkt der Anspruch auf staatliche Leistungen – oder entfällt unter Umständen ganz.
Entscheidend ist die Höhe der BU-Rente. Wer beispielsweise weniger als 1.000 € monatlich aus seiner Versicherung erhält, kann unter Umständen dennoch anspruchsberechtigt sein – insbesondere bei hohen Mietkosten oder besonderen Lebenslagen. Allerdings wird der Großteil dieser BU-Rente auf den Bedarf angerechnet. Nur bestimmte Freibeträge schützen Teile des Einkommens vor der vollständigen Anrechnung.
Im Jahr 2025 gelten folgende Grundwerte: Der Grundfreibetrag für erwerbsunfähige Personen liegt bei 12.096 € jährlich (für Alleinstehende). Kleinere Einmalzahlungen oder geringe Vermögenswerte bleiben bis zu einem Schonvermögen von 15.000 € anrechnungsfrei. Für Ehe- oder Lebenspartner gelten zusätzliche Freibeträge, insbesondere beim gemeinsamen Wohnen oder geteilten Einkommen.
Die Anrechnung kann in der Praxis dazu führen, dass die BU-Rente nicht zu einer echten Verbesserung der finanziellen Lage führt, sondern lediglich die staatliche Unterstützung reduziert. Daher ist es sinnvoll, schon bei der Vertragsgestaltung auf eine ausreichend hohe BU-Rente zu achten – damit diese auch nach Anrechnung über dem Grundsicherungsniveau liegt.
Nicht selten kommt es vor, dass eine zu knapp kalkulierte BU-Rente von der Grundsicherung aufgefangen werden muss – ein Szenario, das vermeidbar ist. Eine frühzeitige und realistische Absicherung schützt davor, im Leistungsfall trotz Versicherung auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein.
Ein weiterer Aspekt: Die Herkunft der BU-Rente kann die Anrechenbarkeit beeinflussen. Renten aus privaten Verträgen, die vollständig selbst finanziert wurden, gelten als vorrangig zu verwertendes Einkommen. In seltenen Fällen – etwa bei rückwirkend ausgezahlten Leistungen – kann es auch zu Einmalanrechnungen kommen, die den Anspruch auf Grundsicherung temporär entfallen lassen.
Zusätzlich sollten Betroffene beachten, dass nicht nur die eigene Rente, sondern auch Einkünfte des Ehepartners oder anderer Haushaltsangehöriger bei der Anrechnung berücksichtigt werden können. Auch diese Regelung kann die tatsächliche Unterstützung durch den Staat schmälern.
Fazit: Die Berufsunfähigkeitsrente kann den Anspruch auf Grundsicherung mindern – muss es aber nicht. Wer Freibeträge kennt, die gesetzlichen Regeln versteht und im Vorfeld plant, kann sich finanziellen Spielraum sichern. Für Personen mit geringem Einkommen oder unsicherer Erwerbsbiografie ist eine frühzeitige Beratung besonders ratsam, um böse Überraschungen im Leistungsfall zu vermeiden.
Wie viel bleibt von der BU-Rente wirklich übrig?
Netto-BU-Rente in der Praxis: Drei Beispiele, wie Steuern und Abgaben Ihre Auszahlung beeinflussen
Die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente sagt wenig darüber aus, was am Ende tatsächlich auf dem Konto landet. Entscheidend sind Steuerpflicht, Krankenversicherungsbeiträge und Sozialabgaben. Die folgenden Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Netto-Rente je nach Vertragsart und persönlicher Situation ausfallen kann.
Wer seine Berufsunfähigkeit absichert, orientiert sich oft an Bruttobeträgen – dabei zählt im Ernstfall nur die Nettoleistung. Denn erst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben zeigt sich, ob die gewählte Absicherung den Lebensstandard sichert oder eine Versorgungslücke bleibt. Die nachfolgenden drei Beispiele zeigen typische Konstellationen, die in der Praxis häufig vorkommen – jeweils auf dem Stand 2025:
Beispiel 1: Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU)
Ein alleinstehender Versicherter wird mit 40 Jahren berufsunfähig und erhält eine monatliche BU-Rente von 2.000 €. Der Vertrag ist eine klassische SBU (Schicht 3).
Der maßgebliche Ertragsanteil beträgt 27 %, was zu einem steuerpflichtigen Betrag von 540 € im Monat führt. Aufs Jahr gerechnet ergibt sich ein zu versteuerndes Einkommen von 6.480 €. Da der Grundfreibetrag 2025 bei 12.096 € liegt, fällt keine Einkommensteuer an.
Die Person ist gesetzlich krankenversichert. Nach Anwendung der Beitragsformel (Rente × 0,82) ergibt sich ein beitragspflichtiger Wert von 1.640 €. Daraus ergeben sich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von rund 330 € monatlich.
→ Netto-BU-Rente: ca. 1.670 €
Beispiel 2: BUZ mit betrieblicher Altersvorsorge (bAV)
Ein Arbeitnehmer hat über den Arbeitgeber eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung abgeschlossen, die an eine bAV gekoppelt ist. Die monatliche BU-Rente beträgt 1.800 €.
Da es sich um eine Leistung aus der zweiten Schicht handelt, wird die Rente vollständig besteuert. Bei einem Steuersatz von z. B. 20 % ergibt sich eine Steuerbelastung von ca. 360 €. Zudem fallen GKV- und Pflegeversicherungsbeiträge in Höhe von etwa 295 € an.
→ Netto-BU-Rente: ca. 1.145 €
Beispiel 3: BUZ mit Rürup-Rente (Basisrente)
Ein selbstständiger Versicherter hat eine BUZ im Rahmen einer Rürup-Rente abgeschlossen. Die monatliche Rentenzahlung beträgt 2.200 €. Im Jahr 2025 sind davon 85 % steuerpflichtig. Das ergibt einen steuerpflichtigen Betrag von 1.870 €, was bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 25 % zu einer Steuerlast von rund 470 € führt.
Da die Person privat krankenversichert ist, muss sie weiterhin ihre vollen Beiträge in Höhe von ca. 400 € pro Monat tragen.
→ Netto-BU-Rente: ca. 1.330 €
Diese Beispiele zeigen: Die Abzüge variieren erheblich – trotz ähnlicher Bruttorenten. Ohne genaue Planung und Verständnis der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen kann die BU-Rente deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben.
So vernetzen Sie Ihre BU-Planung mit weiteren wichtigen Entscheidungen
Weitere Inhalte, die beim Thema Berufsunfähigkeit für Sie relevant sein könnten
Die Höhe der Netto-BU-Rente hängt nicht nur von Steuern und Sozialabgaben ab – sondern auch davon, ob der Leistungsfall eintritt, wie Ihr Vertrag technisch ausgestaltet ist und ob ergänzende Informationen berücksichtigt wurden. Die folgenden Themen bieten Ihnen wichtige Orientierung.

Wann zahlt die BU-Versicherung?
Nicht jede Arbeitsunfähigkeit führt automatisch zur BU-Leistung. Die versicherte Person muss ihren Beruf zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben können. Wir zeigen, worauf es im Leistungsfall ankommt und welche Nachweise erforderlich sind.

Technische Vertragsausgestaltung
Ob Verweisungsverzicht, Leistungsbeginn oder Karenzzeit: Technische Vertragsmerkmale beeinflussen die Absicherung maßgeblich. Wir erklären, worauf Sie bei der Tarifauswahl achten sollten – mit Beispielen und Klartext.
Wie Sie mit kluger Planung mehr Netto aus Ihrer BU-Rente herausholen
Steuern und Abgaben bei der BU-Rente reduzieren: Tipps zur Optimierung Ihrer Nettoleistung
Auch wenn sich Abzüge bei der BU-Rente nicht vollständig vermeiden lassen, gibt es verschiedene Stellschrauben, um die steuerliche und soziale Belastung zu reduzieren. Entscheidend ist die richtige Vertragsgestaltung, eine realistische Kalkulation der Rentenhöhe und die Nutzung vorhandener steuerlicher Möglichkeiten.
Die Berufsunfähigkeitsrente wird im Leistungsfall schnell zur zentralen Einkommensquelle – entsprechend wichtig ist es, dass von der vereinbarten Bruttorente möglichst viel beim Versicherten ankommt. Mit durchdachter Planung und steuerlichem Know-how lässt sich die Abgabenlast zumindest teilweise reduzieren.
Eine wichtige Maßnahme besteht darin, die passende Vertragsform zu wählen. Wer auf eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) setzt, profitiert im Leistungsfall von der Besteuerung nach dem Ertragsanteil. Das bedeutet: Nur ein Teil der BU-Rente wird überhaupt steuerpflichtig – was bei niedrigen Gesamteinkünften oft dazu führt, dass keine Steuern gezahlt werden müssen. Wer hingegen auf geförderte Modelle wie bAV oder Rürup setzt, sollte die langfristige Steuerlast bereits beim Abschluss einkalkulieren.
Ein weiterer Hebel ist die korrekte Einschätzung der Rentenhöhe. Viele Versicherte orientieren sich an ihrem Nettoeinkommen – vergessen dabei aber, dass im Leistungsfall neue Abzüge entstehen. Die BU-Rente sollte daher etwas über dem aktuellen Nettoeinkommen angesetzt werden, um Spielraum für Steuern und Krankenversicherungsbeiträge zu lassen.
Auch die Nutzung von Freibeträgen und Sonderausgaben kann helfen. Beiträge zu einer Rürup-Rente mit integriertem BU-Schutz sind bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 26.528 € (Stand 2025) steuerlich absetzbar. Zwar wirkt sich das erst in der Ansparphase aus, doch dieser Vorteil kann genutzt werden, um die eigene Steuerbelastung insgesamt zu senken. Zusätzlich können bestimmte Beiträge zur BU als Sonderausgaben geltend gemacht werden – vor allem bei reinen Risikoversicherungen ohne Sparanteil.
Darüber hinaus gibt es in einigen Fällen steuerfreie Einmalzahlungen aus BU-Verträgen. Diese werden nicht als wiederkehrende Einkünfte gewertet und bleiben unter bestimmten Bedingungen außerhalb der Einkommensteuerpflicht. Ob dies sinnvoll ist, hängt vom Tarif und der vertraglichen Gestaltung ab.
Nicht zuletzt sollte auch die Wahl der Krankenversicherung nicht außer Acht gelassen werden. Wer privat versichert ist, kann mit Beitragsentlastungstarifen vorsorgen, um die finanzielle Belastung im Leistungsfall abzufedern. Gesetzlich Versicherte sollten im Blick behalten, dass freiwillig Versicherte auf sämtliche Einkünfte Beiträge zahlen – auch auf Kapitalerträge oder Mieteinnahmen.
Fazit: Wer rechtzeitig plant, die steuerlichen Regeln kennt und die eigene Absicherung nicht zu knapp kalkuliert, kann seine Netto-BU-Rente spürbar optimieren. Eine fachkundige Beratung hilft dabei, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen.
Hintergründe, Einblicke und Antworten – konkret und praxisnah
Was Sie schon immer über Abzüge bei der BU-Rente wissen wollten
Warum ist der Ertragsanteil bei der BU-Rente so entscheidend?
Der Ertragsanteil bestimmt, wie viel der BU-Rente steuerpflichtig ist – je kürzer die Laufzeit, desto höher der zu versteuernde Anteil. Bei einer langen Rentenlaufzeit fällt der Ertragsanteil geringer aus, was steuerliche Vorteile bringt.
Kann sich der Krankenversicherungsstatus während der BU-Rente ändern?
Ja, das ist möglich. Zum Beispiel können gesetzlich Versicherte in die freiwillige Versicherung rutschen, was zu höheren Beiträgen führt. Umgekehrt können privat Versicherte ihren Tarif unter bestimmten Bedingungen anpassen oder wechseln.
Muss ich meine BU-Rente in der Steuererklärung angeben?
Ja, alle BU-Leistungen – auch wenn sie nur anteilig steuerpflichtig sind – müssen in der Steuererklärung aufgeführt werden. Das gilt auch für Einmalzahlungen oder rückwirkend geleistete Rentenzahlungen.
Was passiert mit meiner BU-Rente, wenn ich nebenher wieder arbeiten kann?
Wer teilweise berufsunfähig ist und eine reduzierte Tätigkeit aufnimmt, muss mit einer anteiligen Anrechnung rechnen. Je nach Versicherungsbedingungen kann dies zur Kürzung oder zum Wegfall der Rente führen – ohne steuerliche Entlastung.
Gilt meine BU-Rente auch als Einkommen für Wohngeld oder Elternunterhalt?
Ja, die BU-Rente zählt in beiden Fällen als Einkommen. Beim Wohngeld kann sie den Anspruch reduzieren, beim Elternunterhalt wird sie ggf. bei der Leistungsfähigkeit berücksichtigt.
Können sich Abzüge auf bestehende Kreditraten oder Unterhaltspflichten auswirken?
Indirekt ja. Wenn die Netto-Rente geringer ausfällt als geplant, kann das zu Engpässen bei laufenden Verpflichtungen führen. Eine zu knapp kalkulierte BU-Rente kann damit finanzielle Folgerisiken auslösen.
Wird meine BU-Rente im Ausland auch besteuert?
Das hängt vom jeweiligen Wohnsitzland ab. Deutschland behält in der Regel das Besteuerungsrecht bei – im Ausland lebende Empfänger müssen sich zudem mit dem dortigen Steuerrecht auseinandersetzen.
Gibt es einen Unterschied zwischen lebenslanger und befristeter BU-Rente?
Ja – insbesondere steuerlich. Bei einer befristeten Rente (abgekürzte Leibrente) gilt das Ertragsanteilsprinzip. Bei lebenslangen Leistungen können andere steuerliche Regelungen greifen, je nach Ausgestaltung.
Sind Nachzahlungen aus der BU-Rente steuerlich problematisch?
Rückwirkende Zahlungen können im Jahr der Auszahlung das zu versteuernde Einkommen stark erhöhen. Mit der Fünftelregelung lässt sich die Steuerlast aber oft glätten – hier lohnt der Gang zum Steuerberater.
Was ist bei einer BU-Rente im Rentenalter zu beachten?
Ab dem regulären Renteneintritt kann es zur Überschneidung mit anderen Leistungen (z. B. gesetzlicher Rente) kommen. Steuerlich werden dann alle Rentenarten zusammen betrachtet, was die Gesamtsteuerlast deutlich erhöhen kann.
Zusammenfassung
Die Berufsunfähigkeitsversicherung zählt zu den wichtigsten privaten Absicherungen im Erwerbsleben. Doch vielen Versicherten ist nicht bewusst, dass die vereinbarte Rente im Leistungsfall nicht in voller Höhe zur Verfügung steht. Steuern, Sozialabgaben und mögliche Anrechnungen auf staatliche Leistungen reduzieren die Nettoauszahlung oft erheblich. Entscheidend ist dabei nicht nur die Höhe der Rente, sondern vor allem, wie der Vertrag steuerlich eingeordnet ist – ob selbstständig abgeschlossen oder als Zusatzbaustein mit einer geförderten Altersvorsorge wie Rürup oder bAV kombiniert.
Bei selbstständigen BU-Versicherungen erfolgt die Besteuerung nach dem Ertragsanteil – was bei niedrigen Einkommen oft steuerfrei bleibt. Geförderte Verträge hingegen unterliegen einer nahezu vollständigen Besteuerung. Zusätzlich wirkt sich der Krankenversicherungsstatus auf die Höhe der Abzüge aus: Gesetzlich Versicherte zahlen prozentuale Beiträge, privat Versicherte müssen ihre monatlichen Beiträge weiterhin in voller Höhe selbst tragen.
Auch die Anrechnung auf Sozialleistungen wie die Grundsicherung spielt eine Rolle – besonders bei niedrigen Rentenhöhen. Freibeträge bieten zwar einen gewissen Schutz, verhindern aber nicht grundsätzlich eine Kürzung staatlicher Leistungen. Wer sich vor versteckten Lücken schützen möchte, sollte deshalb frühzeitig planen, realistische Rentenhöhen wählen und die steuerlichen Auswirkungen bereits beim Abschluss der BU-Versicherung mitdenken.
Unsere Praxisbeispiele zeigen deutlich: Selbst bei gleichen Bruttobeträgen können sich die Nettoleistungen um mehrere Hundert Euro unterscheiden – je nach Vertragsart, Steuersituation und Versicherungsschutz. Eine gezielte Optimierung der Absicherung zahlt sich also aus – nicht erst im Leistungsfall, sondern schon bei der Entscheidung für den passenden Tarif.
häufige Fragen
Wie hoch ist der steuerpflichtige Anteil meiner BU-Rente?
Das hängt von der Art der Versicherung ab. Bei einer selbstständigen BU-Rente (Schicht 3) wird nur der sogenannte Ertragsanteil besteuert – abhängig vom Alter bei Rentenbeginn. Bei geförderten Verträgen wie Rürup oder bAV ist die Rente zu 85 % bzw. 100 % steuerpflichtig.
Muss ich als gesetzlich Versicherter Sozialabgaben auf meine BU-Rente zahlen?
Ja, gesetzlich Versicherte zahlen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf ihre BU-Rente. Als Faustformel gilt: 82 % der Rente werden als beitragspflichtige Einnahme angesetzt.
Kann meine BU-Rente auf die Grundsicherung angerechnet werden?
Ja. Die BU-Rente gilt als Einkommen und wird auf die Grundsicherung angerechnet. Es gibt jedoch Freibeträge und Sonderregelungen, die einen Teil der Leistung schützen können.
Wie kann ich meine BU-Rente steuerlich optimieren?
Die optimale Lösung hängt von der Vertragsform ab. Selbstständige BU-Verträge haben meist steuerliche Vorteile im Leistungsfall. Wer eine Kombination mit Rürup oder bAV wählt, sollte die höhere Steuerlast bei der Rentenzahlung berücksichtigen.

